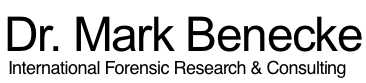Blutauftropfspuren werden seit weit über hundert Jahren zur Rekonstruktion von Tathergängen eingesetzt. Die Form der einzelnen Tropfen ist - anders als die Betrachtung des Blutspurenmusters als Gesamtbild - jedoch sehr variabel und wird in der Gutachtenpraxis mitunter vernachlässigt. Auch aus wissenschaftlicher Sicht ist dieses Spezialfachgebiet noch nicht ausreichend beforscht, da einige grundlegende Fragen nach wie vor der Klärung bedürfen.
Read More1996 Kriminalistik: Die DNA-Beweise im Fall Simpson
Im Strafprozeß gegen den Ex-Footballspieler O.J. Simpson, der mit einem Freispruch endete, zeigte sich erneut die enorme Leistungsfähigkeit der DNA-Typisierung. Dennoch führten die Schwächen und Eigenheiten der amerikanischen Rechtsprechung dazu, daß die DNA-Beweise letztlich wenig Gewicht erhielten. Weil der Fall Simpson derjenige ist, auf den wir im Moment am häufigsten angesprochen werden, soll er an dieser Stelle einmal im Detail betrachtet werden. Zugleich soll eine Übersicht über den heutigen Stand der Individualidentifikation mittels DNA-Analyse gegeben werden, die zeigt, daß Verläßlichkeit und Geschwindigkeit der Diagnosestellung weiter zunehmen.
Read MoreInternational Society for Forensic Genetics Benecke Discrimination of monocygotic twins and clones on the DNA level
ng methods (RFLP, STR, RAPD; e.g. [3]) do not allow discrimination of monocygotic twins. To overcome this restriction, we suggest the use of variable DNA sequences of bone-marrow derived memory B lymphocytes that are likely to be different even in monocygotic twins. Since memory B cells are transported in the blood stream, they can be found in blood stains on crime scenes and checked for a match to the cells of a living pair of twins. The size of the antibody repertoire has been estimated to comprise theoretically up to 1010 specificities [2].
Read MoreGenetic Fingerprints Benecke Coding or non-coding DNA typing
Having solved the last technical hurdles to extract DNA information from virtually any biological material, forensic biologists now have to ponder the ethical and social questions of using information from exonic DNA
Read MoreThe Genetic Imaginary: DNA in the Canadian Criminal Justice System by Neil Gerlach
The book by sociologist Neil Gerlach starts with a theoretical outline about possible fears of society about developments and results of biotechnologies, e.g. transgenic animals, genetically engineered food, possible demands for a right to normalcy ("new eugenics"), patenting genes, and "charismatic science." The next section deals with the "culture of the trace" and DNA fingerprinting in terms of criminal applications and the impact on judicial proceedings. This is put into the context of an apparently widespread and, in the eyes of the author, unrealistic fear of crime in Canada. It is argued that the use of DNA in legal contexts may lead to a "surveillance society."
Read MoreGenetischer Fingerabdruck
Anwendungsgebiete, Methoden, Auswertung der Ergebnisse, zukünftige Entwicklung und rechtliche Aspekte
Quelle: Der Große Brockhaus, Enzyklopädie in 30 Bänden, 21. Auflage, F.A. Brockhaus, Leipzig, S. 449-454
Mark Benecke
Abstract
MB gibt im Großen Brockhaus zum Schlüsselbegriff "genetischer Fingerabdruck" (Kapitel: Gene) den aktuellen Stand des Wissen wieder. Anschaulich und umfassend werden sowohl die biologischen Hintergründe als auch die Bedeutung der relevanten Methoden für die kriminalistische Praxisarbeit dargestellt. Trotz der rasanten Entwicklung seit dem Erscheinungsjahr (2005), bietet der Übersichtsartikel eine durchweg handfeste Grundlage zur weiteren Einarbeitung in das Themengebiet.
Den kompletten Artikel gibt es HIER (.pdf)
Entomologie heute: What is the Edge of a Forest
Aufgrund des Fundes einer erwachsenen, toten Pilzmücke mit dunklen Flügeln (Bradysia sp., Sciaridae), die normalerweise an Waldrändern vorkommt, auf einer Leiche am Rand eines Waldes im Westen Deutschlands wurden wir während der Gerichtsverhandlung von der Verteidigung und von der Staatsanwaltschaft gefragt, was als „Waldrand“ angesehen wird. Über zwei Ferkelleichen haben wir versucht, Parameter für eine solche Definition zu erarbeiten. Der offensichtlichste Unterschied zwischen dem Inneren des Waldes und dem Waldrand lag in der Außentemperatur sowie in der Innentemperatur der verwesenden Ferkel, die im Schwein an der Waldgrenze höher war. Insgesamt wurden 957 Fliegen aus 56 verschiedenen Arten und zwölf Familien (Anthomyiidae, Calliphoridae, Drosophilidae, Dryomyzidae, Fanniidae, Heleomyzidae, Lauxaniidae, Muscidae, Piophilidae, Phoridae, Sepsidae, Sphaeroceridae) nachgewiesen.
Read MoreArchiv für Kriminologie:Asservierung von Insekten-, Spinnen- und Krebsmaterial für die forensisch-kriminalistische Untersuchung
Die auf Leichen lebenden Gliederfüßer (Arthropoden) können Todesermittlungen durch verschiedene aus jenen ableitbare Schlüsse unterstützen. Neben der Bestimmung der Leichenliegezeit sogar skelettierter Körper (z.B. Lord et al. 1994) ist ein Strauß weiterer Untersuchungen möglich, beispielweise zur postmortalen Verlagerung einer Leiche und zur Intoxikation eines Körpers (Goff & Lord 1994), ggf. auch hier noch nach bereits erfolgter Skelettierung. Auch in in Arbeitsprozessen (Nuorteva 1977), Fällen von Kindesvernachlässigung (Lord 1990), hygienisch-rechtsmedizinischen Fragen (Benecke, eingereicht) und bei der Ermittlung weit von Tatort entfernt lebender Täter (Webb et al. 1983, Prichard et al. 1996) wurden arthropodenkundliche Untersuchungen erfolgreich angewendet. Mittlerweile sind neben den notwendigen Wachstumskurven der Tiere (Reiter 1984, Nishida 1984, Smith 1986) auch viele der möglichen Abweichungen statistisch erfaßt (Schoenly 1992, Schoenly et al. 1996, Introna et al. 1989).
Read MoreForensic Entomology Benecke The Next Step
Since the Second World War only a handful of scientists and crime scene experts have pioneered a way forward for forensic entomology. All of them had the tough job of convincing local authorities, and other scientists, of the benefits of using arthropods in criminal investigations. Judges, in numerous countries, finally decided that forensic entomology was suitable for use in cases ranging from tricky high profile murders to wildlife violations [1-10].
Read MoreGoff Benecke A Fly for the Prosecution
The more pressure is put on scientists to publish in scientific journals, or else to perish, the less likely it gets that an excellent popular science book like A Fly for the Prosecution is written. Being one of the old masters of forensic entomology -- that is, the science of determining post mortem intervals, and many other issues related to mostly violent death --, Lee Goff leads us through his exciting and at the same time entertaining world that strongly depends on silent crime scene assistants: maggots, adult flies and beetles, and once in a while a grasshopper, too. Many of these animals are attracted to decomposing body tissue. Their growth rate, and their succession are predictable, and can therfore be used to estimate the time when they started to feed on a corpse, or the time they got attracted to the body for other reasons like predating maggots, or building breeding chambers.
Read MoreBenecke Einseitiges Auftreten von Maden im Gesicht einer Leiche
The corpse of a 41-year-old medical doctor was found in his bed. The body was part-iaily dried out; parts of the hip region were skeletonized due to maggot activity. In the fa-cial region of the corpse, blowfly maggots (Lucilia (Phaenicia) sericata [Meigen]) were found exclusively in one eye socket. This is an unusual occurrence since on that side, a bed-light (40 W light bulb) had been burning during the seven week post mortem interval. All other lights in the apartment were switched off, and no direct sunlight could enter the space where the body was found (only a TV set had been running all the time, ca. 2 m away from the head at the foot end of the bed). Obviously, the maggots who usually flee light had used up the one eye that was further away from the bedlight as a feeding source. Since the con-tinuing mummification of the corpse led to a substantial restriction of feeding material, the maggots finally switched to the eye that the light was shining on.
Read MoreForensic Entomology: Maggots Murder and Men
Here is that rare thing, a good popular book on forensic entomology that is also an illuminating read on forensic science itself and on the art of being an expert witness. Zakaria Erzinçlioglu (a.k.a. Dr Zak), a forensic entomologist for more than 20 years, covers not only the wonderful world of insects as a tool in forensic investigations, but also the Tertiary geological period, O'nyong-nyong disease, Napoleon Bonaparte, human behaviour, maggot therapy and Sherlock Holmes.
Read MoreForensic Entomology Distinction of bloodstains from fly artifacts
Forensic scientists may encounter blood spatter at a scene which may be pure or a mixture of fly artifacts and human bloodstains. It is important to be able to make an informed identification, or at least advanced documentation of such stains since the mechanics of production of fly artifacts are not determinable to the crime scene reconstructionist from regular police forces. We describe three cases in which experiments and crime scene reconstruction led to additional information. Case 1: Above the position of a victim, numerous blood stains of the low-high velocity type were found. Exclusion of these stains being caused by force (but instead caused by the activity of adult blow flies) by use of the following observations that were confirmed in experiments: a) Sperm-/tadpole-like structure with length > width, b) random directionality c) mixture of round symmetrical and teardrop shaped stains. Case 2: A reddish spatter field was found on a fan chain two rooms away from the place where a dead woman was found. Localization of the spatter on the bottom end of the surface hinted strongly towards fly activity. Case 3: Double homicide; submillimeter stains were found on a lamp between the two corpses. Activity of flies was less likely compared to alternative scenario of moving lampshade and violent stabbing.
Read MoreWhat is the edge of a forest (EAFE)
We tried to experimentally address a "simple" question that came up during a homicide trial in Aachen, Germany. Some dead adult flies of the genus Bradysia (Sciaridae) had been recovered from a corpse that was found on grassland close to a forest. Bradysia is known to live on the borders of forests. Relating to this expert witness statement, defense and prosecution asked: "Alright, but what is an edge of a forest?"
Read MoreMedellin - Insekten auf Leichen in Kolumbien
Medellin ist eine riesengroße Stadt, die in etwa die Rolle Kölns hat: Man lässt sich von “denen da oben” nix sagen, feiert stattdessen lieber kräftig und nennt sich stolz “Paisa”. Ein(e) Paisa ist bodenständig, echt und gehört nicht zu den (angeblich) Großkopferten aus Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens.
Read MoreA brief survey of the history of forensic entomology
The fact that insects and other arthropods contribute to the decomposition of corpses and even may help to solve killings is known for years. In China (13th century) a killer was convicted with the help of flies. Artistic contributions, e.g. from the 15th and 16th century, show corpses with “worms”, i.e. maggots. At the end of the 18th and in the beginning of the 19th century forensic doctors pointed out the significance of maggots for decomposition of corpses and soon the hour of death was determined using pupae of flies (Diptera) and larval moths (Lepidoptera) as indicators. In the eighties of the 19th century, when REINHARD and HOFMANN documented adult flies (Phoridae) on corpses during mass exhumation, case reports began to be replaced by systematic studies and entomology became an essential part of forensic medicine and criminology...
Read MoreRechtsmedizin: III Simposio Latinoamericano De Entomologia Forense
Quelle: Rechtsmedizin 1: 65-66, 2009.
Ill Simposio Latinoamericano De Entomologia Forense
Medellin, Kolumbien, 31.10 - 3.11.2008
Mark Benecke
Der Zweijahresrhythmus pendelt sich ein und so fand eines der informativsten, abr auch bizarrsten forensischen Trainings im Herbst 2008 zum "dritten" - eigentlich vierten - Mal seit 1999 an der staatlichen Universidad de Antioquia (U de A) in Medelin statt.
Der Kurs erfreut sich trotz Teilnahmegebühr großer studentischer Beliebtheit, weil die Referenten international rekrutiert werden und die Veranstaltung mit viel Theorie, aber auch breit gefächerter Praxis angelegt ist. Weil Kolumbianer nordamerikanische "Gringos" nicht mögen, lud Kursleiterin Marta Wolff (U de A) statt der bekannteren KollegInnen aus den USA und Kanada lieber José Roberto Pujol (Univ. de Brasilia, Spezialist für Waffenfliegen (Stratiomyidae)), Claudio José Carvalho (Univ. Paraná, einer der weltweit bekanntesten Experten für die oft schwierig zu bestimmenden "normalen" Fliegen (Musciden)), den Kriminalbiologen Marco Villacorta (Inst. Rechtsmedizin Perù) sowie unsere ehemalige Studentin und jetzt Gruppenleiterin Sandra Pérez Pareia (U de A) als "Conferencistas" ein.
So sehr sie die Gringos verabscheuen, so sehr lieben unsere StudentInnen Tiere. Daher konnten wir für deutsche Verhältnisse ungewohnt spezialisierte Vorträge über insektenkundliche Details bringen. Sogar die geladenen StaatsanwältInnen, KriminaltechnikerInnen und PolizistInnen ließen sich davon nicht schrecken, weil sie wissen, dass auch Insekten-Fragmente und Verhaltens-Beobachtungen von Adulten - und eben nicht nur die reine Bestimmung des postmortalen Intervalles über deren Larven - zielführend sein können.
Wegen der in Kolumbien sonst nie verfügbaren ausländischen Besucher wurde die Zahl der von StudentInnen vorgestellten Experimenten leider reduziert, was aber durch biogeographischen Diskussionen, ausgelöst durch die abweichenden Wachstsumsraten, Mindesttemperaturen und allgemein sehr diversen Umweltbedingungen an Küsten, Innenland, heissen Tälern, tropischen Wäldern und Bergen (Medellin und Bogota liegen beispielsweise in den Bergen) in Südamerika abgelöst wurde. Wir leben in Europa in dieser Hinsicht auf einer Insel der Glückseligen, weil die Umweltbedingungen nicht nur besser untersucht und dokumentiert, sondern in Kriminalfällen auch leichter verfügbar und vor allem von Grund auf weniger mannigfaltig sind.
Einen Höhepunkt erreichte die örtlich extrem hohe Gewaltgewöhnung, als sich die Polizei mit der von der Guerilla unterwanderten StudentInnenbewegung direkt neben dem Insekten-Labor der Universität und mitten im Kurs eine etwa fünfstündige Schlacht lieferte, die in Deutschland für rasche Gesetzesänderungen und einwöchige Schlagzeilen auf Seite Eins sorgen, die KolumbianerInnen aber nur die Augenbraue zucken lassen ließ.
Die verwendeten Wurf-Geschosse sind dabei so genannte "papa bombas": Wegen ihrer Form und Größe erinnern sie an eine Kartoffel (papa). Diese kleinen Bomben können leicht selbst gebaut werden und haben einen kurden, innen liegenden Kontaktzünder, der beim auftreffen - egal, ob auf den Boden oder den Helm des Polizisten - explodiert. Die Polizei darf, angeblich laut Erlass des Präsidenten Uribe, die Universität aber weder ernsthaft beschießen noch betreten, so dass die einzige Möglichkeit der Gegenwehr ein Beschuss des Universitäts-Hofes mit Tränengas war. Kurzerhand zündeten die kampferprobten StudentInnen alle Mülleimer an (soll das Tränengas verbrennen) oder stülpten alte Fässer über die auftreffenden Kartuschen (mechanische Gas-Barriere), so dass dieses Problem beseitigt und das Getöse weiter gehen konnte. Mit Einbruch der Dunkelheit machten beide Seiten "Feierabend" (O-Ton; auch "bei Regen gibt es grundsätzlich nie Kämpfe, weil man dann ja nass würde"). Der Kurs wurde zum Erstaunen der fliegenkundlichen KollegInnen aus Peru und Brasilien wegen dieser offenbaren Nebensächlichkeiten übrigens keine Minute unterbrochen.
Spannend gestaltete sich auch der schon traditionelle Ausflug zu den von uns ausgelegten, verwesenden Schweinen und Hasen im Erholungsgebiet Piedras Blancas, das von ehemaligen StudentInnen und SchulkollegInnen der Kurs-Chefin verwaltet wird und daher für uns als Experimentier-Gelände zugänglich ist. Neben Geiern und Vogelspinnen leben dort in den Bergen auch Kriebelmücken (Simuliiden), die interessante Stichmuster erzeugen. Zu Beginn breitet sich ein breiter, ganz flacher Hof aus, der beim Abschwellen vulkanartig aufbiegt und - anders als die hier bekannteren Stechmücken (Culicidae)-Verletzungen - zentral eine runde, wie ausgestochene, Verfärbung aufweist. Wie auch Herbstgrasmilben (Neotrombicula)-Bisse können diese Wunden gut zur Datierung einer Leichenablage verwendet werden, allerdings durch Beobachtung der Entzündung beim Täter und nicht durch Verwendung der Larven von der Leiche. Neben Fliegen gibt es also auch im Reich der Mücken und Milben viele forensische Anwendungsmöglichkeiten, die vor allem der Polizei als ersteingreifende Einheit nahe gebracht wurden.
Landesweites Interesse erregte zuletzt noch ein Vortrag über die Untersuchung von Hitlers Schädel und Zähnen, der eigentlich nur als kleines Bonbon gedacht war, dann aber in den Parque Exploare (riesiges naturwissenschaftliches Museum) verlegt wurde. der Andrang war so groß, dass sich um das Gebäude herum eine lange Warteschlange bildete. Mehr als alles erstaunte die KolumbianerInnen offenbar Hitlers Kokaingebrauch ("Einreibungen" ins Zahnfleisch), der zur sehr deutlichen Zerstörung seiner Kiefer beitrug. Obwohl es sich um einen populärwissenschaftlichen Vortrag handelte, war das Frage-Niveau so hoch wie hierzulande auf einem Fachkongress.
Insgesamt zeigte der für südamerikanische Verhältnisse schon fast uhrwerkartig straff organisierte Kurs erneut, dass die lateinamerikanischen und portugiesischen Gebiete, vom Rest der Welt fast unbeachtet, einen interessanten, kompetenten und eigenständigen - leider aber auch wissenschaftlich oft isolierten - Gegenentwurf zu dem darstellen, was wir als sozialen, forensischen und kulturellen Konsens ansehen. Wer zu einer solchen Veranstaltung eingeladen wird oder sie mit organisiert, darf sich glücklich schätzen, weil sie sehr breit gefächerte und neue Ideen für eine veränderte Herangehensweise an randständige - beispielsweise überbrutale oder kulturell motivierte - Kriminalfälle bieten.
Dr. Mark Benecke über Sherlock Holmes und dessen Untersuchungsmethoden
Quelle: The Baker Street Chronicle (2)7, Seiten 12 bis 13 (2012)
VON OLAF MAURER
Hallo Mark, Du bist von Anfang an Mitglied in der Deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft. Wie siehst Du Deine persönliche Beziehung zu dem berühmtesten Detektiven aller Zeiten?
Alle kriminalistischen Regeln, die ich anwende, finden sich bei Sherlock Holmes, und das fand ich, als ich es bemerkte, ganz persönlich strange und gruselig, jetzt aber saucool. Endlich bin ich nicht mehr alleine der Kauz, der so komisch querdenkt und in der Schule als einziger (kein Scherz, war ‘ne echte Umfrage in unserer Schule) Chemie gut fand! ;)
Natürlich ist das mit den kriminalistischen Regeln kein Zufall, denn mehrere Regeln sind altbekannt und implizit sozusagen eine Job-Beschreibung, einige sind aber auch neu oder zumindest so originell, daß ich ihren Ursprung nicht kenne und sie mal auf den juten Sherlock datiere.
Beispiel:
Während in Krimis oft das Einschlußprinzip verwendet wird (gibt‘s auch bei Holmes: „There is nothing like first-hand evidence.‘ -- Study in Scarlet), ist es aber oft genug (bei Holmes) auch andersrum, und das ist sehr aufregend und wichtig, da es genauso beweiskräftig ist:
Erst wenn man alles ausgeschlossen hat, was nicht sein kann, muß das, was übrig bleibt, stimmen, egal wie unwahrscheinlich es ist.
Dieser Satz kommt bei Holmes öfters und in Varianten vor, und man könnte Tage damit verbringen, ihn auszulegen. Er nimmt alles Mögliche vorweg, beispielsweise das Falsifikationsprinzip von Popper und schließt einiges Ungemütliche ein, beispielsweise, daß es nicht so ganz einfach ist, alles auszuschließen. Am wichtigsten im kriminalistischen Alltag: daß man nie fragen soll, was wahrscheinlich ist oder lebensnah. Das führt Annahmen ein, und die führen dann zu zwar logischen, aber auf einer falschen Grundannahme beruhenden Gedankenkette:
“‚I never guess. It is a shocking habit destructive to the logical faculty.‘ (SIGN)
‚Having gathered these facts, Watson, I smoked several pipes over them, trying to separate those which were crucial from others which were merely incidental.‘ (CROO)”
Man kann solche Zitate eigentlich gar nicht genug erwähnen. Das Dumme ist nur, daß man beim ersten Lesen gar nicht rafft, how very elementary far beyond any poetic truth das alles wirklich ist (zumindest habe ich es am Anfang nicht gerafft).
Ich nehme jetzt einfach wenige, relativ bekannte Zitate von einer der zahlreichen Sherlock-Holmes-Zitate-Seiten im Internet:
a.
You see, but you do not observe. The distinction is clear.‘ (SCAN)
Kommentar: Man liest dieses Zitat, aber man versteht es nicht. Ein großer Unterschied ;) – Wie am Tatort: Alles voll Blut, aber man muß die Besonderheiten in diesem Meer an Selbstverständlichkeit (Halswunde: Blutaustritt: langweilig) erstmal erkennen, etwa Blut an einer zwar erwartbaren Stelle, aber unerwartbar geformt.
b.
He [Holmes] loved to lie in the very centre of five millions of people, with his filaments stretching out and running through them, responsive to every little rumor or suspicion of unsolved crime. (RESI)
Das trifft beispielsweise im Knast zu. Wenn man da mit einer Person redet, redet man eigentlich mit allen. Es ist ein Netz, in dem viele Taten miteinander zu tun haben, in dem es Kontakte nach innen und außen gibt und in dem die Einzeltat wirklich kaum eine Rolle spielt und man versuchen muß, die jahrelangen Verbindungen der Menschen dort zu verstehen. Ich höre also oft und gerne einfach zu.
*© Photo by Thomas van de Scheck
c.
‚My mind is like a racing engine, tearing itself to pieces because it is not connected up with the work for which it was built.‘ (TWIS)
„My mind,“ he said, „rebels at stagnation. Give me problems, give me work, give me the most abstruse cryptogram or the most intricate analysis, and I am in my own proper atmosphere. I can dispense then with artificial stimulants. But I abhor the dull routine of existence. I crave for mental exaltation. That is why I have chosen my own particular profession,—or rather created it, for I am the only one in the world.“ (SIGN)
Kenne ich. Mir ist nie langweilig, ich finde immer was zu tun, notfalls putze ich oder sortiere Kram um. Befriedigend und beruhigend ist es aber nur, komplizierte Spuren zu untersuchen.
d.
‚Nothing clears up a case so much as stating it to another person.‘ (SILV)
‚I confess that I have been blind as a mole, but it is better to learn wisdom late than never to learn it at all.‘ (TWIS)
Ohne meine StudentInnen, MitarbeiterInnen und auch das Publikum bei öffentlichen Vorträgen wäre ich echt aufgeschmissen. Beim Reden werden ganz andere Gehirnbereiche aktiv und viel mehr Verbindungen geknüpft. Wichtig dabei: man muß die anderen Menschen wirklich respektieren und darf NIEMALS glauben, man wäre schlauer. Die meisten Menschen denken aber, daß sie im Kern korrekte und sinnvolle Ansichten haben, viele andere Menschen aber nicht. Über die bin ich also regelrechter Menschenfreund geworden, der gerafft hat, wie cool und wertvoll und oft auch stark andere wirklich sind.
‚A man should keep his little brain attic stocked with all the furniture that he is likely to use, and the rest he can put away in the lumber-room of his library where he can get it if he wants.‘ (FIVE)
Interpretiere ich so, daß man zwar neugierig sein soll und wissen, wen man als Experten fragen kann, aber nicht wie in manchen modernen TV-Krimis (CSI) ein Alleskönner sein soll -- es ist viel besser, sich mit wenigen Dingen im Speziellen auszukennen und für den Rest jeweils angepaßte Teams zusammenzustellen und dort offen und einzelfallbezogen zusammenzuarbeiten.
e.
‚It has long been an axiom of mine that the little things are infinitely the most important.‘ (IDEN)
‚It is, of course, a trifle, but there is nothing so important as trifles.‘ (TWIS)
Ist mein Leben.
Nach Deiner Einführung geht es um die Frage bzw. den Umstand, daß Holmes auf Leichen einschlägt, um die Entwicklung von blauen Flecken bei Leichen zu erforschen. (STUD) Wie stehst Du zu solchen Methoden, zu solchen Wegen zur Erforschung von gewissen Umständen?
Da stehe ich sehr zu. Beispielsweise gab es mal einen Bericht darüber, daß der DNA-Gehalt in Strangmarken verändert sein sollte. Das ließ uns keine Ruhe. Also sind ein Kollege und ich hingegangen und haben künstliche Strangmarken an Leichen erzeugt sowie vor allem ganz kleine Hautproben von Suizidenten, die sich erhängt hatten, entnommen.
Ergebnis: durch das Zusammendrücken der Haut ändert sich die Gewebedicke und das -gewicht, aber nicht der DNA-Gehalt pro Zelle.
Das sah man aber erst, als wir a. die Proben veraschten und b. eben den DNA-Gehalt bestimmten. Ergebnis Nummer zwei: der Artikel GRELLNER W & BENECKE M (1997) The quantitative alteration of the DNA content in strangulation marks is an artifact. Forensic Science International 89:15-20
Heute völlig undenkbar, da müßte man vermutlich erst Ethik-Kommissionen usw. befragen, die es evtl. trotz der Korrektur eines Fehlers, der sich bereits in die Fachliteratur eingeschlichen hatte, nicht erlauben würden.
Schon damals wehte ein komischer Wind, wenn man ins Labor Leichengewebe brachte oder einfach mal etwas TESTETE, anstatt immer nur nachzudenken: meine damalige Chefin hat die Hautproben, die ich noch weiter untersuchen wollte, eines Tages einfach weggeworfen. Hammer, ich wüßte bis heute noch spannende, wichtige Fragen, die wir an diesen Proben immer noch prüfen könnten, beispielsweise zur Genetik von Depressionen (ich bin Posterboy für ein Anti-Depressions-Netzwerk: frnd.de).
Engstirnigkeit oder Ekel sind da leider sehr schädlich. Findet Holmes ja auch:
„One‘s ideas must be as broad as Nature if they are to interpret Nature.“ (STUD)
Was wollte Holmes hier genau erforschen (1887)?
Antwort aus dem Original zusammengestellt:
„Holmes is a little too scientific for my tastes—it approaches to cold-bloodedness.(...) He appears to have a passion for definite and exact knowledge (...) but it may be pushed to excess. When it comes to beating the subjects in the dissecting-rooms with a stick, it is certainly taking rather a bizarre shape. [He does it] to verify how far bruises may be produced after death.“
Warum ist dies wichtig?
Wir schlagen (pun intended) uns öfters mit postmortalen Verletzungen rum. Die können vor Gericht tödlich (pun intended – again) sein. Typisches Beispiel: Ehegattin tot, Kratzer am Hals der Leiche, Ehemann kriegt ne fette Auszahlung der Lebensversicherung, die beiden haben sich oft gestritten, er hat kein Alibi.
Sehr dumm, wenn die „Kratzer“ erst nach dem Tod durch Schnecken entstanden sind oder durch Lagerung auf einem Ast, weil die Frau einfach nach einem (Blut)Sturz so hingefallen und liegen geblieben ist. Wirklich ein sehr realer Klassiker vor Gericht. Über sowas sind schon kollegiale Freundschaften zerbrochen, weil der Erstgutachter der Anklage helfen wollte und hinterher rauskam, daß es eben doch nur ein Fleck vom Stock oder ein Hautabrieb von der Schnecke war.
Wie würde man das heute tun – wie würdest DU das tun?
Genau so, wenn ich dürfte. Allerdings wäre es vermutlich illegal, so daß ich notfalls vor Gericht sagen müßte, daß ich das Experiment nicht machen durfte und daher nicht weiß, wie die Antwort lautet. Wenn’s sehr hoch hängen würde, würde ich es einfach im Ausland machen.
Beziehungsweise hättest Du zur damaligen Zeit ggf. ähnlich gehandelt?
Hundert Prozent ja.
Mit herzlichem Dank an Olaf Maurer und die Redaktion des Baker Street Chronicles für die Freigabe und die Genehmigung zur Veröffentlichung.
Das Copyright des im PDF abgebildeten Fotos von Mark Benecke liegt bei Thomas van de Scheck, dem wir an dieser Stelle ebenfalls recht herzlich für die und die Genehmigung zur Veröffentlichung danken!
Interview mit Dr. Mark Benecke (Sherlock Holmes Magazin)
Quelle: Sherlock Holmes Magazin, Herbstausgabe 2012, Seiten 16 bis 18
Interview mit Dr. Mark Benecke
VON RALF BILKE & MARCUS KONRAD
*© Photo by Thorsten Fröhlich,
Im August diesen Jahres begleiteten Ralf Bilke und Marcus Konrad den 1970 geborenen Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke und durften ihn und seine Studenten einen halben Tag lang bei seiner Arbeit beobachten. Die Atmosphäre war von Anfang an locker - und bereits nach wenigen Minuten war man beim "Du" angelangt.
Der Nachmittag begann mit einer Exkursion, in deren Rahmen heimische Baumarten, inklusive pflanzeneigener Partikel, die beispielsweise bei Leichenfunden wichtig werden könnten, unter die Lupe genommen wurden. Selbst der Verzehr von Eibenbeeren, dem einzigen Teil der Eibe, der nicht hochgiftig ist, stand auf dem Programm, sowie das Ernten einer Kirschengattung, um deren Kerne zu rösten, zu mahlen und daraus eine Art Muckefuck zu kochen. "Das Entfernen des Fruchtfleischs machen meine Schaben", erklärte Benecke. Das macht Mut.
Weiter ging es mit einem Interview in Herrn Beneckes Arbeitszimmer, das schon ein kleines Kuriositätenmuseum für sich ist. Sherlock Holmes stellt für Benecke den Prototypen in Bezug auf kriminalistische Methoden und Spuren dar, wie man dem Interview entnehmen kann.
Zum Abschluss wurde es noch einmal praktisch: Mikroskopieren ganz in guter Sherlock Holmes-Art.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Mark für seine aufgeschlossene und herzliche Art.
Mark, Du hast gesagt, dass alles was heute kriminalistisch gemacht wird, schon mal dagewese und bei Doyle und Sherlock Holmes wiederzufinden ist. Kannst du vielleicht darüber etwas erzählen?
Ihr kennt ja vielleicht die Zitate aus der Holmes-Wiki und die Pdf's auf meiner Homepage benecke.com. Darin werden die wesentlichen Prinzipien genannt, die ich mal ausführen möchte. Diese sind zwar kriminalistisch geläufig und ich habe sie unabhängig von sherlockianischen Publikationen oder Regeln entwickelt, so wie sie jeder entwickelt. Eine typische Regel, die für Kriminalisten logisch wäre, ist das Locardprinzip. Es gibt keine Tat oder Interaktion ohne Spurenübertragung. Aber das Prinzip, so gut es auch ist, ist sinnlos, denn alles im Leben ist durch irgendetwas bedingt. Es ist also nett und auch richtig, wenn man den Leuten sagt, sucht nach Spuren, denn es muss irgendeine Spur geben, eine Fußspur, eine Glasspur, eine DNA-Spur, eine Spermaspur, eine Haarspur, oder wie bei Sherlock Holmes eine Tabakspur. Aber das ist zu offen. Bei Sherlock Holmes sind die Prinzipien besser. Diese sind zwar auch offen, aber kriminalistisch spezifischer. Erstens, man soll keine Annahmen machen, und das leitet eine kritische Einzelfallbetrachtung ein: Ich nehme nicht an, dass diese Situation vergleichbar ist mit einer anderen Situation. Und dadurch ist man gezwungen zu sagen: Ich muss mir vor Ort alle Details ansehen.
Das Zweite ist, dass man sagt: Egal wie nebensächlich es ist, es ist trotzdem wichtig. So ist das bei einer Faserspur: das ist zwar nur Staub in der Ecke und somit nebensächlich, kann aber sehr wichtig sein. Aber auch Großes kann nebensächlich sein.
Das Wichtigste ist aber das Ausschlussprinzip. In Krimiserien siehst du meistens nur Einschlüsse. Der Detektiv Iäuft durch die Gegend und kommt nach und nach durch Spuren, die er findet, und durch Zeugenaussagen der Sache immer näher. So funktionieren Krimis. Aber das Ausschlussverfahren bedeutet, dass man erstmal ausschließen muss, was nicht sein kann. Wenn zum Beispiel hier in der Wohnung eine Leiche gefunden wird, muss man sich klar machen, von wem die DNA unter den Fingerngeln der Leiche ist, aber ich könnte auch genauso gut fragen, wer kann es nicht gewesen sein, weil die Leute nicht da sind, weil sie in Urlaub sind und das ist die noch bessere Methode, weil sie eine noch bessere Einengung dessen erlaubt, was man eigentlich vorhat. Das ist der erste Teil, und der zweite Teil von diesem Satz, der in vielen Geschichten auftaucht, ist: Erst wenn man alles ausgeschlossen hat, was nicht stimmen kann, muss das stimmen, was übrig bleibt., egal wie unwahrscheinlich es ist. Und das ist sozusagen schon die vierte Regel. Nämlich dass man sich ganz klar machen muss, dass es scheißegal ist, wie naheliegend, lebensnah, vernünftig, logisch, planbar oder sonst etwas das Ganze ist. Deswegen sind die Sherlock Holmes-Geschichten wirklich gut. Es gibt ja moderne Krimiautoren, die kritsieren die teilweise logischen lnkonsistenzen in den Geschichten. Das sehe ich aber nicht. Ich glaube eher, dass die modernen Krimiautoren nicht raffen, welche Prinzipien dahinterstecken und nicht, dass die Geschichte durch die Spurensuche und durch die Zeugenaussagen oder durch logische Kombination auf ein Ziel hin läuft. Das sind also die vier Prinzipien, die ich am Wichtigsten finde.
Du scheinst Dich in den Geschichten gut auszukennen.
Ja, ich habe mir neulich die Gesamtausgabe zugelegt und nochmal gelesen. Wir haben an der Harvard-Universität eine Zeitschrift, bei der wir einmal im Jahr Spaßnobelpreise verleihen für Sachen, die echte Forschung sind, die sich aber aber lustig anhören. Da haben wir das letztgenannte Prinzip übernommen. Bei Sherlock Holmes heißt es ja, egal wie unwahrscheinlich es ist. Wir haben das als Motto übernommen. Es hat aber zehn Jahre gedauert, bis ich gerafft habe, dass das auch für Arbeit bedeutsam ist.
Das bedeutet, Du bist schon in jungen Jahren zu Sherlock Holmes gekommen.
Ja, ich muss da irgendwie als Kind schon dazu gekommen sein und habe es jetzt nochmal aufgegriffen.
Viele Erfahrungen des Autors fließen ja in die Sherlock Holmes-Geschichten hinein. Doyle hat ja viele Erfahrungen, die er durch Bell, seinem Mentor, gemacht hat, übernommen. Die Prinzipien sind gleich, aber was hat sich Deiner Meinung nach radikal verändert.
Das ist schwer zu sagen. Mit der Industrialiserung ist es so gekommen, dass völlig klar war, dass technische Prinzipien Erfolge haben. Man kann damit Geld verdienen, Arbeiter ernähren, man kann damit Städte aufblühen lassenn. Es war klar, dass Geld, Macht, Erfolge daran gekoppelt sind. Das hat sich überall widergespiegelt. Das sieht man bei Conan Doyle auch. Zum Beispiel bei Bram Stokers DRACULA hat man den ganzen Aberglauben, über den man geschmunzelt hat, der aber doch sehr mächtig und vorhanden war, wie heute auch noch. Hente ist es zum Beispiel Homöopathie und so was, worüber sich die Leute irgendwann totlachen werden. Deshalb tauchen bei Bram Stoker auch Sohreibmaschinen auf, was damals ja total crazy war. Als Zeichen für die technische Entwicklung. Da prallt Logisches und Irraionaes aufeinander. Bei Sherlook Holmes ist es so, dass das gar nicht auftaucht. Da gibt es nur eine düstere Atmosphäre, die ja manchmal auch in Filmen aufgegriffen wird, aber er selber ist der Kauz, der Nerd. Und mit der Industrialisierung war auf einmal der Kauz nicht mehr der, den man umbringen möchte. Vorher waren Köhler oder Müller immer die zwielichtigen Figuren, die am Stadtrand gewohnt haben, die teilweise aber auch schräg oder intelligent sein konnten. Das waren Spinner, Störenfriede und die wurden an den Stadtrand gedrängt oder einfach umgebracht.
Mit der Industrialisierung wurde der Sonderling, solange er genützt hat, sympathisch. Der größte Nutzen, den ein Sonderling haben kann, ist als Techniker oder als Kriminalitätsaufklärer. Dadurch wird die Gesellschaft stabilisiert, wenn man weiß, da ist einer, der kann Verbrechen aufklären. Das war immer da. Die Spezialisten gab es immer, aber erst durch die Industrialisierung wurde das auf einmal sexy oder cool. Zum Bespiel bei den neuen Verfilmungen (Downey) ist es ja so, wenn man mit jungen Frauen spricht, die finden den sexy. Oder bei der neuen BBC-Serie. lch würde sagen, der Typ ist ein arrogantes Arschloch, ich weiß nicht, was daran sexy ist.Aber dann heißt es immer, nee, der ist so kIug und sportlich und so. Also wenn ich einen Typen in der Schule gehabt hätte, ich hätte den total bekloppt gefunden. Bei Arthur Conan Doyle ist Sherlock Holmes ja noch sonderlich und kauzig, drogenabhängig, schizoid, schmuddelig und so. Heute ist der Nerd sogar sexy geworden.. Bei den anderen Krimis wird es ja meistens so gelöst, dass der Todesermittler durch irgendetwas traumatisiert ist. Deswegen ist er nicht mehr Teil der Gesellschaft, sondem Todesermittler. Das Thema wird bei Sherlock Holmes überhaupt nicht angeschnitten. So wie Bram Stoker viele Fäden zusammen geknüpft hat, die schon da waren, hat Doyle das nachgemacht. Und auf Deine Frage nach Doyles Mentor, solche Leute gab es auch immer, aber die mussten ihren Platz finden. Paracelsus und Archimedes waren mit Sicherheit genauso. Die Leute gab es immer, sie haben es nur sehr schwer. Nicht umsonst sind viele davon getötet worden. Die Leistung von Conan Doyle ist sehr stark unterschätzt, weil das eigentlich Kriminalistik-Lehrbücher sind, ohne dass das jemand rafft. Doyle macht sie besonders cool. In dem Moment, wo man ein Lehrbuch liest und es nicht merkt, das ist die Königsdisziplin. Besser geht es nicht mehr! Man muss aber noch mehr anerkennen, dass Doyle, der so tief durchdrungen war von seinem Glauben an die Esoterik und wirklichen Humbng, den er eigentlich hätte erkennen müssen, das auf zwei verschiedene Schienen geblickt hat. Ich wüsste keinen Autor, der das jemals wieder schaffte. Das ist eine irrsinnige Leistung. Das private Gedankengebäude dringt normalerweise immer irgendwie in den Text ein.
Das bedeutet, dass Du jetzt als Kriminalbiologe, die Geschichten, die als Kind als Abenteuer gelesen hast, jetzt als Lehrbücher siehst.
Richtig, es gibt ja auch die schöne Liste von Watson, was kann Holmes und was nicht. Das ist eine ganz typische Liste für Spezialisten. Denn eigentlich musste man, wenn man einen Spezialisten sexy findet, erwarten, dass er sich mit allem auskennt. Ich finde es sehr gut dargestellt, dass Holmes sich eben mit fast überhaupt nichts auskennt, außer mit Klatschblättern, Blutanalysen und Chemie. Das ist realistisch und bei mir genauso. Das würde ich nicht als Kriminalbiologe sehen, sondern als jemand, der schon sehr lange sehr komplizierte Fälle bearbeitet. Ebenso wie Sherlock Holmes: Als naturwissenschaftlicher Kriminalist, ein Beruf, den Doyle und Poe erfunden haben.
Wenn man sich hier umsieht, ist das Thema Spiritismus ja allgegenwärtig. Du interessierst dich sehr für Vampirismus.
Ja, aber auch für alle anderen schrägen Sachen. Ich würde das aber nicht als esoterisch ansehen, ich sehe mir auch alle Subkulturen an. Zum Beispiel beim Satanismnus schaue ich: gibts das überhaupt? Und wenn es das gibt, was machen die da überhaupt? Ich würde es eher extreme Randgebieten nennen, weil du sonst die schrägen Fälle gar nicht verstehen kannst. Die breite Kenntnis ist wichtig.
Wenn man die Geschichten aus der Zeit von Stoker oder Doyle liest, ist ja vieles sehr mystisch oder mythisch. Das war damals die Zeit. Wie siehst Du das heute? Ist unsere Zeit entzaubert?
Gerade die viktorianischen Schockeffekte waren ja ein literarischer Kniff. Aber das ist heute noch genauso.Das Gruselige oder die Schockeffekte sind in Krimis heute noch genauso. Die mystischen und mythischen Fehlinterpretationen gibt es heute genauso, hängen sich aber an anderen Sachen auf. Das Rätselhafte und das Gruselige, gekoppelt mit dem, dass man eigentlich viele technische Möglichkeiten hat, die es eigentlich aufklären sollten und dann die daraus folgenden Fehlinterpretationen, das ist genau dasselbe. Und in der Nacht passiert eben auch ganz viel. Quietschende Fenster machen den Leuten genauso Angst wie früher.
Ist es bei Dir im Job genauso, dass viele das für unheimlich und gruselig halten, es aber für Dich reine Routine ist?
Nein, es ist das Gegenteil von Routine und bei Shedock Holmes ist es so, dass er ja höchstbegabt ist und darum ist ihm immer langweilig. Darum nimmt er auch Drogen und hat keinen Bock, aufzuräumen. Ich arbeite öfter mit hochbegabten Jugendlichen zusammen. 80 % davon haben aber keinen Bock und nur 20% sind überhaupt leistungsinteressert. Ich würde sagen, dass Holmes die Routine langweilt und nur, wenn ein spannender Fall kommt, zieht ihn das aus der Lethargie raus. Das ist bei uns ähnlich. Ich bin nicht hochbegabt, aber bei mir ist es so, dass ich früher viel Routinearbeit gemacht habe, zum Beispiel DNA-Analysen. Heute mache ich lieber die schweren, komplizierten Fälle, die kein Mensch machen würde. Und vor Geisteern habe ich keine Angst. Das Holmes-Zitat, wir brauchen keine Geister, ist bei mir ähnlich. Wenn ich welche sehe, und seien es nur die Geister der anderen, dann habe ich keine Angst davor. Das ist die Ähnlichkeit mit Sherlock Holmes. Also wenn etwas Gruseliges passiert, sage ich nicht, ich weiß sofort was das ist und wenn's ein Geist ist, dann lebe ich damit. Ich arbeite erst mal mit der einfachsten Annahme, dass es kein Geist ist. Wenn es aber tatsächlich einer wäre, lasse ich es auf mich zukommen und lebe damit. Die meisten Leute machen es anders. Die sagen, wenn es ein Geist sein könnte, gehe ich gar nicht erst auf den Dachstuhl und schaue, was das ist. Das ist der Unterschied.
Wo ist denn jetzt für Dich die Schwelle, was ist Arbeit, die Dich herausfordert und DU sagst, da bin ich voll in meinem Element.
Also, ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Nehmen wir mal an, es sitzt jemand im Knast - lebenslänglich und rechtskräftig verurteilt. Es besteht keine Möglichkeit mehr, jemand anderen anzuzeigen. Der erzählt mir jetzt etwas, das ist so unglaublich, da müsste er etnweder sehr intelligent sein oder ein sehr guter Lügner oder beides. Er sagt, er habe darüber nachgedacht und erzählt mir eine dermaßen abgedrehte Geschichle, bei der man sich sagt, dass sie als Ausrede nicht funktioniert, denn damit würde er sich nur noch mehr reinreiten. Das ist für mich interessant. Denn an diesen Geschichten hängen oft Spuren dran. Und dann kann man auch nach zehn Jahren nochmal an den Tatort und nach Spuren suchen. Deswegen reist Sherlock Holmes ja auch immer überall hin. Also das ist der Moment, wo es interessant wird: Schräge Geschichte, gekoppelt an eine mögliche Spur.
Was hältst Du persönlich von Sherlock HoImes-Verfilmungen?
Ich habe mir mal die alten schwarz-weiß-Filme geholt und die sind so naja. Aber von der neuen Serie (BBC) habe ich mir nur die ersten drei Folgen angesehen. Das ist mir zu übereichnet. Diese Arroganz ist total übertrieben und die Figur in meinen Augen von den Machern völlig falsch verstanden. ln den originalen Geschichten ist Holmes nicht arrogant, im Gegenteil. Er schmunzelt über die Schwächen der Menschen, so wie wir alle, aber er reduziert es immer auf den sachlichen Gehalt. Es soll in der Serie nachher besser geworden sein, aber das habe ich mir nicht mehr angesehen. Holmes stellt sich nicht über die Menschen, er bettet sich gerne ein, indem er sich zum Beispiel als Bettler verkleidet. Das hat mit Arroganz nichts zu tun. Was allerdings sehr gut gemacht ist und wo der Drehbuchautor die Figur auch verstanden hat, ist im ersten Guy-Richie-Film. Das ist eine sehr gute moderne Umsetzung. Da ist alles drin was wichtig ist.
Du hast ja beruflich viel mit dem Tod zu tun; was sind Deine Gedanken zum Leben und zum Spiritismus wie zum Beispiel bei Conan Doyle?
Also, tot ist tot, aber ich bin offen für jede Art von Gedankenmodell, weil die Welt, die wir als Realität wahrnehmen, ein Konstrukt unseres Gehirns ist und es wäre lächerlich zu sagen, dass derjenige, der ein rationalistisches Weltbild hat wie SherlockHolmes eine realere Realität erlebt, als jemand, der Stimmen hört und Bäume umarmt. Die Frage ist her, welche Methode verwende ich, um Schlüsse zu ziehen. Und darum finde ich es bei Doyle so toll, dass er die Grenzen eingehalten hat. Also: "Woran glaube ich? Ich glaube an Elfen auf Fotos oder Feen. Ich glaube an spiritistische Sitzungen und Ektoplasma. Aber wenn ich Schlussfolgerungen ziehen, die ich darstellen will, zum Beispiel bei Sherlock Holmes, dann lasse ich das komplett raus, weil es da nicht reinpasst." Normalerweise sickert bei Autoren immer etwas aus ihrer eigenen Gedankenwelt ein. Zum Beispiel zeigt Stephenie Meyers TWILIGHT die Vampire als Mormonen. Kein Sex vor der ehe usw., im Grund sind das mormonische Vampire, weil die Autorin Mormonin ist. Das ist bei Doyle nicht der Fall, und das ist eine großartige Leistung.
Abschließend, was würdest Du sagen oder Deinen Studenten raten. Lest lieber Doyle anstelle des modernen Zeugs?
Also moderne Krimis lese und besitze ich nicht. Nicht, dass ich es als Trainer eines kriminalistischen Lehrgangs fordern würde, aber meine Meinung ist, dass man vor Beginn des Studiums mal alle originalen Sherlock Holmes-Geschichten gelesen haben sollte. Auch das Wiederauftauchen nach seinem angeblichen Tod - aus welchen Gründen auch immer, was ja auch in DALLAS und anderen Serien tausendfach verwendet wurde, dass der scheinbar Tote wieder aufersteht - ist eine gute Schule dafür, welche Wendungen kriminalistisch passieren können, eben durch Notwendigkeit: Dinge, die keinen Sinn ergeben, di aber trotzdem passieren. Ich kann jetzt nicht sagen, dass man das andere nicht lesen soll, ich kann aber sagen, dass Sherlock Holmes völlig ausreicht und es keinen Grund gibt, etwas anderes zu lesen.
Dem haben wir nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für dieses Interview.
Mit herzlichem Dank an Ralf Bilke, Marcus Konrad und die Redaktion des Sherlock Holmes Magazins für die Freigabe und die Genehmigung zur Veröffentlichung.
Doktor Made mags einfach (Migros Magazin)
Quelle: Migros Magazin, Saisonküche, Nr. 6. 6. Februar 2012, Seiten 84-87
Doktor Made mags einfach
Copyright: Dominik Asbach (Migros Magazin)
Die Fötzelschnitten der «Saisonküche» sind genau nach seinem Geschmack: einfach, gut und wohlriechend. Nur im Beruf mags Kriminalbiologe Mark Benecke gerne knifflig. Und gegen schlechte Gerüche ist er dann immun.
Text: Dora Horvath
Köln, Südstadt, Landsbergstrasse 16. «Dr.Mark Benecke - Consulting, Kriminalbiologische Forschung und Beratung» ist auf einem Messingschild an der Hausfassade zu lesen. Wir treffen uns an Beneckes Arbeitsplatz, einer zum Labor umfunktionierten Drei-Zimmer-Wohnung.
Sie befindet sich in der dritten Etage eines freudlosen Wohnblocks aus der Zeit des Wiederaufbaus der frühen Nachkriegsjahre. Beim Eintreten erfüllt ein dezenter Weihrauchduft aus Mark Beneckes dunkel möbliertem Büro die ganze Wohnung. Was für eine Überraschung für «Saisonküche»-Köchin Janine Neininger. Hatte sie doch vielmehr einen olfaktorischen Keulenschlag befürchtet, einen Geruch nach Verwesung, womit Mark Benecke (41) bei seiner täglichen Arbeit immer wieder konfrontiert ist.
«Hi! Soll ich Kaffee machen?», begrüsst er uns. Seine kölsche Kumpelhaftigkeit, die schwarzlederne Kluft, die Tattoos und die drei Silberringe passen nicht zum gängigen Klischee eines Naturwissenschafters seines Kalibers. Der vereidigte freiberufliche Sachverständige, der schon beim FBI und in der New Yorker Rechtsmedizin gearbeitet hat, gehört zu den renommiertesten Spurenkundlern und gefragtesten gerichtlichen Insektenforscher der Welt.
Zu seinem Job gehört es, an einem Tatort sämtliche biologischen Spuren zu untersuchen, unter anderem Insekten und Insektenlarven auf und um Tote.
Entsprechend publikumswirksam wird er in Talkshows, Radiosendungen und Vortragsreisen, die ihn immer wieder auch in die Schweiz führen, als «Dr.Made» gehandelt. Madenhirte ist ihm aber lieber. «Ich mag wirbellose Tiere. Überall da, wo es andere Leute eklig und gruselig finden, gibt es für mich Neues zu entdecken», erzählt Benecke. Während Janine Neininger in der Küche die Äpfel für das Kompott rüstet, ist plötzlich ein Zischen zu vernehmen.
Beneckes vielfach miteinander verschwägerte Madagaskar-Fauchschaben, die in einer grossen Plastikbox leben, sind am Erwachen. Die nachtaktiven Tierchen haben schon etliche Auftritte im Fernsehen hinter sich. Doch Mark Beneckes Beruf ist alles andere als spektakulär. Er löst keine Fälle und überführt auch keine Täter wie seine Berufskollegen in der TV-Serie «CSI». «Ich halte mich an die Fakten und vermeide es, die Fakten über das Faktische hinaus zu interpretieren.»
Oft beschäftigt er sich mit Fällen, die Jahre zurückliegen und wieder aufgerollt werden. Auftraggeber können ebenso verurteilte «Knackis», Angehörige, Opfer wie auch die Staatsanwaltschaft oder die Polizei sein. Beneckes Methode: alle bisherigen Erkenntnisse zurück auf null stellen, quer denken, zweifeln. Beispielsweise fragt er sich, ob die Insekten, die damals am Tatort eingesammelt und konserviert wurden, tatsächlich in der Gegend vorkommen. Oder ob das Verbrechen an einem anderen Ort geschah. «Erst wenn alles ausgeschlossen ist, was nicht sein kann, muss das, was übrig bleibt, stimmen. Egal, wie unwahrscheinlich es ist», zitiert er Arthur Conan Doyle, den Schöpfer von Sherlock Holmes. «Ich gehe mit dem Verstand eines Vierjährigen und mit der Verfassung eines dementen Greises an die Fälle heran.
Dazwischen gibt es nichts. Mir ist sowieso alles viel zu kompliziert.» Während er Janine Neininger verrät, dass er es auch beim Essen einfach mag, nehmen die Brote Farbe an. Gerade beim Einfachen zeigt sich die Kunst der professionellen Köchin: Die «Armen Ritter» sind picobello angezogen. Benecke beisst, bevor sie angerichtet sind, schon hingebungsvoll hinein. Nur eines gelingt Janine Neininger an diesem Tag nicht: dem waschechten Kölner beizubringen, dass es Fotzelschnitten und nicht Fötzelschnitten heisst.