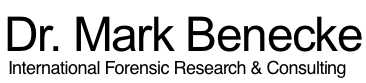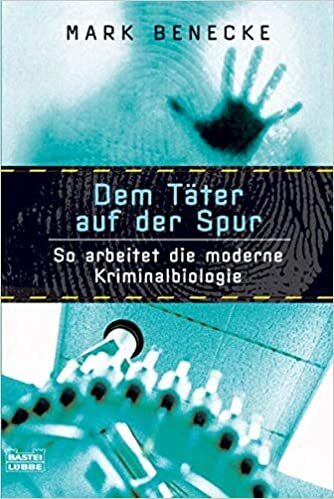Quelle: Welt.de (online) am 14. Oktober 2016
VON PHILIPP HUMMEL
Wie kann die DNA von Uwe Böhnhardt bei der Leiche von Peggy Knobloch aufgetaucht sein? Der Kriminalbiologe Mark Benecke erklärt Hintergründe und mögliche Fehler bei forensischen Erbgutanalysen.
Wie kam die DNA von NSU-Mitglied Uwe Böhnhardt an ein Beweismittel im Fall Peggy Knobloch? Erst wenn diese Frage geklärt ist, weiß man, ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden des Mädchens aus Bayern und den damals deutschlandweit aktiven Terroristen des nationalsozialistischen Untergrunds gibt.
Die im Fall Peggy zuständige Staatsanwaltschaft Bayreuth hält sich bedeckt. Der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel betont, es gebe mehrere Möglichkeiten der Verunreinigung. Man wolle alle potenziellen Fehlerquellen ausschließen, bevor man weitere Details mitteile.
Der „Spiegel“ hatte zunächst berichtet, dass die Leichen von Peggy Knobloch und Uwe Böhnhardt am selben gerichtsmedizinischen Institut der Uniklinik Jena untersucht worden waren. Sofort gab es Spekulationen über eine mögliche Verunreinigung im Labor, die die Ermittler auf eine falsche Fährte gelockt haben könnte.
Der Bayerische Rundfunk meldete dann jedoch, das LKA München habe die DNA von Böhnhardt an dem bei Peggys Leiche gefundenen Stofffetzen identifiziert. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth wollte das gegenüber der „Welt“ weder bestätigen noch dementieren. Die Uniklinik Jena teilte aber in einer Pressemitteilung am Freitag mit, dass das Objekt mit Böhnhardts DNA jedenfalls nicht im dortigen gerichtsmedizinischen Institut untersucht worden sei. Eine zufällige Übertragung von DNA zwischen beiden Fällen durch das Institut sei ausgeschlossen.
Äußerste Sorgfalt im Labor ist wichtig
Der Kriminalbiologe Mark Benecke ist Experte für die Analyse von DNA-Spuren. Er arbeitet seit 25 Jahren mit der Methode: „Das Problem von Verunreinigungen ist groß, aber lösbar. Es gibt verschiedene Wege, durch die versehentlich DNA aus einem Fall auf Beweismitteln eines anderen landen kann.“ Wichtig sei äußerste Sorgfalt im Labor. Handschuhe müssen ständig gewechselt, Oberflächen mit Alkohol und DNA-zerstörenden Lösungsmitteln gereinigt und potenziell kontaminiertes Analysegerät am besten sofort entsorgt werden.
Braucht man Plastikröhrchen, um darin DNA zu lösen, kippt man beispielsweise eine oder mehrere aus der Tüte aus, statt hineinzufassen. „Greift jemand aus Versehen in die Tüte, muss man sie komplett vernichten“, sagt Benecke. Derjenige könnte eine DNA-Spur, die sich an seinem Handschuh befand, in die Tüte übertragen haben. Die könnte dann in späteren Fällen, in denen Röhrchen aus derselben Tüte verwendet werden, als falsche Spur wieder auftauchen.
Im Labor versucht man mit einer „Straße“ aus Untersuchungsräumen, Verunreinigungen nicht weiter zu verbreiten. Im Eingangslaborraum präpariert der Wissenschaftler aus dem Beweismittel eine Probe der DNA-Spur. Im Fall Peggy könnte das ein Stück des kleinen Stücks Stoff sein, das bei der Leiche gefunden wurde und an dem sich Uwe Böhnhardts DNA befand.
Der Wissenschaftler reibt etwas oder schneidet ein Stück davon ab, den Rest gibt er in eine Papiertüte zur Aufbewahrung. Die abgeschnittenen Fasern oder den Abrieb mit dem mutmaßlichen DNA-Material trägt er in den nächsten Raum, wo die eigentliche Laboranalyse vorbereitet wird. Dabei achtet der Wissenschaftler penibelst darauf, Kontaminationen zu vermeiden, damit sie nicht entlang der Laborstraße einen Raum weiter getragen werden.
Gibt es eine direkte Verbindung?
Benecke weißt noch auf eine andere mögliche Fehlerquelle hin. Es komme vor, dass unerfahrenere örtliche Polizisten die Spurensicherung vornehmen, statt erfahrene Beamte des Bundeskriminalamtes oder eines Landeskriminalamtes. „Die machen eher keinen Fehler, der zu einer solchen Verunreinigung führen könnte.“
Man müsse also genau prüfen, welche Ermittlungsteams wann vor Ort waren und welche Spuren gesichert haben. Anhand von Fotos könne man versuchen zu prüfen, ob mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen wurde, etwa, ob die Handschuhe gewechselt wurden. „Ich gehe in dem vorliegenden Fall aber nicht von einer Verunreinigung aus“, so Benecke.
Ob im Fall Peggy tatsächlich unvorsichtige Ermittler bei der Spurensicherung die DNA von Uwe Böhnhardt an den Fundort der Leiche des kleinen Mädchens mitgebracht haben könnten, oder ob es doch eine direkte Verbindung der beiden Fälle gibt, muss die Staatsanwaltschaft Bayreuth nun klären.
Bereits früher hatte es bei den Ermittlungen gegen den NSU eine Panne bei der Analyse von DNA-Spuren gegeben. Bei der Untersuchung des Mordes an der Polizistin Michèle Kiesewetter waren Wattestäbchen verunreinigt gewesen, weshalb vermeintliche Spuren zu einem Täter plötzlich an vielen und vor allem unwahrscheinlichen Orten aufgetaucht waren. Bald war vom „Phantom von Heilbronn“ die Rede. Dieses „Phantom“ entpuppte sich als Verpackungsmitarbeiterin eines an der Herstellung der Stäbchen beteiligten Unternehmens, der die DNA schließlich zugeordnet werden konnte.
Mit großem Dank an Philipp Hummel und die Redaktion für die Erlaubnis zur Veröffentlichung.