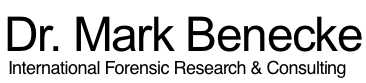Quelle: Schweiz am Sonntag (darin: Kriminalität), Nr. 11 vom 20 März 2016, Seite 9
VON PASCAL RITTER
Mark Benecke (45) ist Kriminalbiologe und Spezialist für forensische Entomologie. Diese Fachrichtung versucht aufgrund von sie befallenden Insekten Hinweise auf den Zeitpunkt des Ablegens einer Leiche zu ermitteln. Beneckes spektakulärster Fall ist die Untersuchung von Adolf Hitlers Kieferknochen, die in einem russischen Archiv lagern. Benecke ist zudem Politiker bei der Satire-Truppe «Die PARTEI».
Herr Benecke, warum fehlt von den Tätern in den Fällen Emmen und Rupperswil jede Spur, obwohl die Ermittler mit modernsten Methoden wie DNA- Tests arbeiten?
MB: Mark Benecke: Die Frage ist, ob es da wirklich keine Spur vom Täter gibt. Gerade in der Schweiz kommunizieren die Strafverfolger Fahndungsergebnisse nur zurückhaltend. Manchmal mauert die Staatsanwaltschaft auch aus politischen Gründen. Es gilt das Motto: Der gute Kriminalist arbeitet still und spricht nicht mit der Presse. Das ist gut für die Arbeit, aber blöd für euch Journalisten.
Am Tatort wurden DNA-Spuren gefunden. Woran könnte es liegen, dass sie noch nicht zum Täter führten?
MB: Eine DNA-Spur allein nützt mir natürlich noch nichts, wenn sich nicht ein entsprechendes Vergleichsprofil in der Datenbank befindet. Dazu müssten die Täter vorher schon mal straffällig oder zumindest verdächtigt gewesen sein. Das Gleiche gilt auch für Faserspuren. Anders als im Krimi kann man mit Fasern von Kleidern der Täter nicht einfach zu allen Pulloverfabrikanten gehen und deren Kundschaft überprüfen.
Wie verzweifelt sind Ermittler, wenn sie 100 000 Franken auf Hinweise aussetzen?
MB: Ich habe noch nie einen verzweifelten Kriminalpolizisten gesehen. Die machen eher auf cool. Die Höhe der Belohnung würde ich nicht überschätzen. Für die reiche Schweiz sind 100 000 Franken nicht sehr viel. Lösegeld wird eingesetzt, um das Umfeld der Täter anzuzapfen. Vielleicht wollen sie die Freundin des Täters weichkochen. Das Lösegeld soll Menschen, die den Täter kennen, ermuntern, sich zu sagen: Ach! Scheiss auf die Freundschaft! Ich nehme die 100 000 und setze mich damit auf eine Insel in der Südsee ab.
Sie haben schon in den USA ermittelt. Würden die Amerikaner im Fall Rupperswil anders vorgehen?
MB: In Europa wird anders ermittelt als in den USA. Nur schon das Material. Ich habe eine Speziallampe, mit deren Licht Substanzen am Tatort sichtbar werden, etwa Sperma. Meine Lampe ist aus Metall und superteuer. Die Amerikaner pfropfen einen Filter auf ihre billige Plastiktaschenlampe. Geht das Ding kaputt, kaufen sie eine neue. Dass die Amis professioneller arbeiten, ist Blödsinn. Sie reden einfach mehr über ihre Arbeit. In den USA gehört ein bisschen Show einfach dazu.
In Rupperswil untersuchten Spezialisten acht Wochen nach der Tat noch mal den Tatort. Was bringt das?
MB: Es bringt immer etwas, den Tatort nochmals anzuschauen. Ich war schon sechs Jahre nach einer Tat an einem Tatort. Man findet immer etwas. Ob Blutspuren, DNA, Fasern oder auch nur Möbel, die irgendwie komisch angeordnet wurden. Ich habe noch nie nichts gefunden an einem Tatort.
Die Aargauer Kantonspolizei hat noch nie so viele Beamte einem einzigen Fall zugeteilt. Gilt bei Ermittlungen, dass vier Augen mehr sehen als zwei, oder ist es eher wie in der Küche: Zu viele Köche verderben den Brei?
MB: Am besten sind viele gute Köche. Dann kann man sich aufteilen und verschiedenen Spuren gleichzeitig nachgehen. Der einsame Kommissar mit der Pfeife im Mund kann die vielen Spezialisten nicht ersetzen. Die Schweiz ist eines der Länder, in denen es viele wirklich gute Fachleute gibt. Der Wissensstand ist sehr hoch.
Das klingt, als hätten Sie schon anderes erlebt.
MB: Ich war mit meinem Team in Ciudad Juárez, der mexikanischen Stadt, in der viele Frauen ermordet wurden. Als wir ankamen, fragten uns die dortigen Ermittler: «Und? Wer ist es gewesen?» Wir fragten nach Spuren. Sie antworteten: «Welche Spuren? Lass uns ein Bier trinken gehen.» Das ist in der Schweiz ganz anders. Die Kollegen arbeiten gründlich und solid.
Auch die Vergewaltigung von Emmen ist noch nicht aufgeklärt. Trotz Massen-DNA-Test. Was halten Sie davon?
MB: Für mich ist es keine soziale Frage, ob man einen Massen-DNA-Test anordnen soll, sondern eine technische. Man muss abwägen, ob sich der Aufwand lohnt. Die Ermittler müssen zudem aufpassen, dass sie nicht getäuscht werden. Es gibt Täter, die einem Komplizen den Pass in die Hand drücken und ihn zum DNA-Test schicken. Nicht zu unterschätzen ist auch die indirekte Wirkung solcher Tests. Manche Täter stellen sich, sobald sie aufgeboten werden. Vor ein paar Jahren hat sich einer in die Luft gesprengt, am Tag bevor er zum DNA-Test musste. Andere gehen als Einzige nicht zum Test und fliegen darum auf.
Kriminologen sprechen vom CSI-Effekt, weil Strafverfolger sich von modernen Ermittlungsmethoden wie DNA-Tests zu viel versprechen.
MB: Tatsächlich hat die Bedeutung vor allem von DNA-Tests zugenommen. Das kann auch die Ermittlungen behindern. Denn die zeitlich-räumlichen Spuren, also Daten zu Fragen wie «wer war wann wo unterwegs?», «wer telefonierte mit wem oder brachte etwas in die Reinigung?» werden im schlimmsten Fall vernachlässigt. Dabei liefern sie oft die entscheidenden Hinweise. Es gibt auch Computerprogramme, die man mit solchen Hinweisen füttern kann und die dann das Puzzle zusammensetzen.
Sind solche Polizei-Datenbanken international vernetzt, sodass Fahndungsresultate oder Tatabläufe abgeglichen werden?
MB: Nein. Die Zusammenarbeit ist sehr schlecht. Es dauerte ewig, bis nur schon die DNA-Spuren in Europa vorsichtig untereinander ausgetauscht wurden.
Wie schätzen Sie die internationale Zusammenarbeit der Schweizer Ermittler ein?
MB: Ich habe nicht den Eindruck, dass die Schweizer sehr schnell mit den benachbarten Ländern die Daten austauschen. Es herrscht die Ansicht vor: Das kriegen wir schon selber hin. Dazu muss ich aber sagen: Die Schweizer kriegen es tatsächlich allein hin. Im Unterschied beispielsweise zu den stolzen Spaniern. Die sind ebenfalls nicht kooperationsfreudig, bekommen aber allein manchmal nur wenig auf die Reihe.
Die Ermittler tappen in den Fällen Emmen und Rupperswil immer noch im Dunkeln. Was könnten sie noch tun?
MB: Sie werden dranbleiben. Oftmals hilft plötzlich Kommissar Zufall. Es gibt sehr viele Beispiele, wo Polizisten bei einer Routinekontrolle etwas Verdächtiges entdeckt, und die Täter zufällig stellten. Es gibt Täter, die gestehen sofort, wenn sie nach einem Zufallsfund befragt werden. Sie sagen: «Also gut, ihr habt gewonnen.» Aber Kommissar Zufall hilft nur, wenn man den Fall auf dem Schirm behält. In der Schweiz ist jeder in ein dichtes Informationsnetz eingebettet. Handydaten, Videoüberwachung, Fahrzeugkontrollen. Da kann es plötzlich sehr schnell gehen, und die Täter gehen ins Netz.
Mit großem Dank an Pascal Ritter und die Redaktion für die Erlaubnis zur Veröffentlichung.