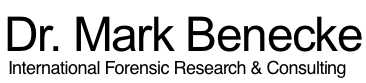Quelle: autismus verstehen, 2/2025
Autismus-Studie für Kita-Kids
Interview: Marie-Louise Abele
Foto: © Klaus D. Wolf
White Unicorn e.V. in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Hochschule Berlin (EHB) und der Arbeiterwohlfahrt (AWO) werten Belastung durch Reize wie Lärm und Unruhe in Lebensumfeldern von autistischen Kindern im Kita-Alter aus. Stephanie Fuhrmann ist Projektmanagerin bei White Unicorn e.V. und hat mit Dr. Mark Benecke bereits das schAUT Projekt zur Erforschung von Barrieren an Schulen für autistische und andere Schülerinnen und Schüler begleitet (www.schaut-verbund.de). Wir berichteten in unserer Ausgabe 2/2024 über die Ergebnisse. Jetzt richten sie ihren Blick auf die Barrierensituation der jüngeren Altersstufe. Das neue Projekt wird von der Aktion Mensch gefördert. Die Umfrage läuft noch bis Ende Oktober 2025. Stephanie Fuhrmann gibt Einblick in den Ablauf und das Ziel des Projektes.
Im vergangenen Jahr haben Sie das Projekt schAUT mit der Umfrage an Schulen abgeschlossen. Was gab nun den Anstoß, die Umfrage auch für den Kita-Bereich zu starten?
Während der Auswertung der schAUT-Umfrage haben wir verstanden, dass Kinder bereits in sehr jungen Jahren lernen können, die eigenen Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten und sich so zu eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln. Dazu braucht es ein Umfeld, in dem sie auf ihre Art die Fähigkeit entwickeln können, in allen Lebenslagen kreativ und handlungsfähig zu bleiben. Wer ständig mit dem Umgang der äußeren Einflüsse beschäftigt ist, sich stetig anpassen muss, hat Probleme, zur Ruhe zu kommen, schläft schlecht und kann sich nicht auf Lösungen bei Schwierigkeiten und das Lernen konzentrieren. Das ist oft schon der Grund für einen schlechten Start in der Grundschule und zieht sich nicht selten durch die gesamte Schullaufbahn hindurch. Besser wird es für alle, wenn Barrieren erkannt und abgebaut werden und das Kind dann noch auf ein verständnisvolles und offenes System trifft. Verhalten wie z. B. Stimming erfüllt viele Zwecke und ist sehr wichtig. Autistische Kinder suchen gezielt Reize, damit ihr Gehirn angeregt wird – zum Lernen, Verarbeiten und Erleben. Das kann ganz einfache Dinge umfassen, wie mit einem Stift wackeln, sich die Haare um den Finger wickeln, mit dem Stuhl schaukeln oder immer wieder dasselbe Wort sagen. Auch Aktivitäten wie Reiten oder Kampfsport können Formen von Stimming sein. Jeder Autist hat seine eigene Art, sich zu stimulieren. Diese Reize helfen, sich wohlzufühlen und überhaupt lernen zu können. In stressigen Situationen wirken sie zudem beruhigend. Ebenso wichtig sind feste Rituale oder die Akzeptanz, wenn ein Kind allein spielen möchte – natürlich mit der passenden Begleitung. Das alles ist Förderung. Das ist Teilhabe.
An wen richtet sich die Umfrage?
Jeder darf mitmachen! Wir suchen Eltern, Familienangehörige, Mitarbeitende in Kita-Einrichtungen und Fachkräfte, welche die Kinder tagtäglich beobachten, aber auch erwachsene Nicht-Autisten, denn wir möchten in dieser Studie alles abbilden, was es neurologisch gibt. Außerdem möchte das Projekt gezielt Bewusstsein für mögliche Stresssituationen für alle Kinder im Kita-Alter schaffen. Unsere Fragen beziehen sich auf aktuelle Ereignisse, die das Kind gerade erlebt, oder Ereignisse, an die man sich selbst erinnert. Welche Hindernisse und sensorische Belastungen gibt oder gab es in der eigenen Kindheit im Alter zwischen 1–6 Jahren? Wie sehr stören sie oder haben sie eigene Handlungsabläufe gestört? Und wie geht man damit um oder wie ist man damit umgegangen?
Wie läuft sie ab?
Bis Ende Oktober 2025 läuft die Online-Befragung, mit der wir die selbst erlebten Hindernisse und Lösungen auf Teilhabe aus allen Lebensbereichen im Kita-Alter erfassen. Danach folgt eine längere Auswertungszeit.
Was ist das Ziel des Projektes?
Wir möchten, dass Kinder auch im Kita-Alter gesund und ausgeglichen aufwachsen können. Durch den Erhebungsbogen und die Pilotstudie mit Praxistest wird als Ergebnis ein ganzes Paket für die Entwicklung und Förderung des Zusammenlebens von Kindern im Alter zwischen 1–6 Jahren erstellt, bei dem auch autistische Kinder nicht ausgegrenzt werden. Dazu werden ein alltagstaugliches Wimmelbild-Kartenspiel, Entwicklungsraster, Workshop für Fachkräfte, Eltern und Interessierte sowie eine als Buch gedruckte Handreichung mit digitaler Fortbildungsveranstaltung entwickelt.
Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit Kindertageseinrichtungen ein stressfreier Ort für alle sein können?
Meiner Meinung nach braucht es vor allem Menschlichkeit. Das beinhaltet das Verständnis für Vielfalt und Diversität in unserer Gesellschaft – ohne Ausnahme. Wenn früh verstanden wird, dass autistische Kinder immer autistisch bleiben, lässt es sich viel einfacher damit umgehen. Denn da ist nichts krank oder muss geheilt werden. Vielmehr ist es wichtig, den Kindern bereits früh die Möglichkeit zu geben, innere Stärke zu entwickeln – sei es durch Angebot von verschiedenen Schutzräumen, sei es ihnen zu erlauben, selbst zu erkennen, wann für sie die Belastungen überhandnehmen. So lernen sie früh, wie sie damit umgehen können, wenn Schwierigkeiten auft reten, z. B. durch Stimming, Kopfh örer, Technologien oder Ruhe und Entspannung. Wir möchten zur Förderung ein Kartensystem gestalten, das bei allen Kindern die Entwicklung der Fähigkeit, Bedürfnisse zu kommunizieren, unterstützen kann.
Die Möglichkeit, schon in jungen Jahren, Autonomie und Teilhabe zu leben, schafft die Basis für ein selbstbestimmtes Leben. Die dafür notwendigen Bedingungen müssen in den folgenden Lebensabschnitten angepasst und weiterentwickelt werden.