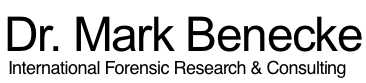Quelle: Süddeutsche Zeitung, 30. Dezember 2022
Von Jakob Wetzel
Joggen im Windschatten, Insektenforscher mit Spinnenphobie oder umgestülpte Dinosaurier: Über Wissenschaft, die erst zum Lachen, dann aber zum Denken anregt.
Kennen Sie den Edmontosaurus? Der hatte vier Beine, einen langen Schwanz und einen pferdeähnlichen Kopf samt Schnabel, und er lebte vor knapp 70 Millionen Jahren dort, wo heute Nordamerika ist. Dank dieses Wesens wissen wir jetzt mehr darüber, unter welch vielfältigen Bedingungen sich Dinosaurierhaut bis heute erhalten, genauer: mumifizieren konnte. Dino-Kadaver wurden in der Regel aufgefressen, deshalb meinte man bislang, Saurier könnten nur mumifizieren, wenn sie plötzlich verschüttet wurden. Doch ein Team um die Geowissenschaftlerin Stephanie Drumheller von der Universität Tennessee-Knoxville zeigte in diesem Jahr im Journal Plos One an einem Edmontosaurus: Das stimmt nicht. Wenn ein Raubsaurier sein Opfer gewissermaßen umstülpte, also das Innere nach außen kehrte, dann lag die Haut innen, und dort war sie halbwegs geschützt und konnte sich ebenfalls erhalten. Wenn Sie also gerne eine mumifizierte Dino-Haut hätten, dann wissen Sie jetzt — ja, gute Frage.
Ein anderes Tier kennen Sie dafür bestimmt: Wale. Aber wussten Sie auch, dass Wale erstaunlich gute CO₂-Senken sein können? Sie können mehr als 100 Tonnen wiegen und bestehen zu großen Teilen aus Kohlenstoff, ihr Kot düngt die Ozeane, und wenn sie sterben, dann zersetzen sie sich auf dem Meeresgrund. Kurzum: Mit Walen ließen sich große Mengen des Klimagases aus der Atmosphäre entfernen und unter dem Meer deponieren. Das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um die Biologin Heidi Pearson der University of Alaska Southeast kürzlich in der Zeitschrift Trends in Ecology and Evolution beschrieben.
Damit sind wir dem Verständnis des Klimasystems einen weiteren kleinen Schritt näher gekommen. Und die Frage ist nur noch: Was genau machen wir jetzt damit? Sollte man womöglich massenweise Wale züchten? Wie viele zusätzliche Wale bräuchte es, um einen messbaren Effekt zu erzielen?
Über diese zwei Studien aus dem Jahr 2022 ist leider selten berichtet worden. Und es gibt viele weitere versteckte Perlen der Wissenschaft. Wussten Sie zum Beispiel, dass finnische Männer umso häufiger Geld bei Pferderennen verwetten, je höher ihr Intelligenzquotient ist? Dass männliche Profi-Fußballer im Schnitt um 30 Prozent seltener alkoholkrank sind als ihre Fans? Oder dass Fische sich gerne an der relativ rauen Haut von Haifischen reiben, um Parasiten loszuwerden — allerdings nur dann, wenn sie so groß sind, dass sie der Hai nicht mal eben schnell hinunterschlucken kann, für den kleinen Hunger zwischendurch? Auch das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Jahr herausgefunden.
Wozu diese Erkenntnisse konkret nütze sind? Das ist nicht immer leicht zu sagen. Doch die Frage ist verkehrt. Die richtige wäre eine rein rhetorische: Was ist das nur für ein Glück, dass es diese Forschung gibt?!
Wissenschaft kann unmittelbar nützlich sein. Wie groß ihr Einfluss auf eine Gesellschaft und das Wohlergehen der Menschen ist, hat man besonders in den vergangenen Jahren erlebt. Plötzlich standen Kameras und Mikrofone im Raum und Wissenschaftler, die eben vielleicht noch fasziniert Mikroben in Petrischalen beim Sichvermehren zugesehen hatten, sollten nun erklären, welche Regeln Regierungen aufstellen sollten, um Leben zu schützen. Später wurden ihnen politische Entscheidungen um die Ohren geschlagen, die sie gar nicht getroffen hatten.
Diese Wissenschaft ist offensichtlich brauchbar. Doch wer die unmittelbare Nützlichkeit allein zum Maßstab nimmt, könnte das Gros der Forschung aus dem Blick verlieren. Wissenschaft ist mehr als nur das Entwickeln und Testen von Impfstoffen, das Modellieren von Epidemien oder auch das Berechnen von Klimamodellen. Wissenschaft besteht aus Theorien, aus Hypothesen und Experimenten, deren Nutzen sich Außenstehenden oft nicht sofort erschließt. Aber ist solche Forschung deshalb unnütz? Muss sie überhaupt unmittelbar nützlich sein? Wie wird man ihr gerecht?
Gar nicht, sagt Mark Benecke. Mit der Frage nach Nützlichkeit komme man nicht weiter: "Da verzettelt man sich total." Wichtig sei, dass etwas wissenschaftlich ist. "Jede Messung, die sauber durchgeführt wird, ist Wissenschaft. Egal, was gemessen wird."
Benecke, bekannter Kriminalbiologe, ist Mitherausgeber der Annals of Improbable Research, einer US-amerikanischen Zeitschrift, die jährlich die sogenannten Ig-Nobelpreise verleiht. Das sind Spaßpreise, mit denen kuriose Studien prämiert werden. Der Name leitet sich her von "ignoble", was "unwürdig" bedeutet; die Preisträger werden traditionell mit Papierfliegern beworfen. Doch der Ig-Nobelpreis ist kein Negativpreis wie die "Goldene Himbeere" im Filmgeschäft. Es geht nicht um schlechte Forschung, die es auch zahlreich gibt: zum Beispiel Studien mit zu kleinen Stichproben oder mit einem schlechten Versuchsaufbau, die nicht erfassen, was sie zu messen vorgeben, und deren Ergebnisse nicht zu gebrauchen sind.
Der Ig-Nobelpreis prämiert dagegen Forschung, die seriös ist, nur eben auch lustig: die erst zum Lachen, dann aber zum Denken anregt. 2022 zum Beispiel wurden unter anderem Forscher geehrt, die mathematisch bewiesen hatten, dass über Erfolg und Misserfolg weniger Talent entscheidet als vielmehr vor allem Glück. 2021 ging einer der Ig-Nobelpreise an Wissenschaftler, die in verschiedenen Ländern Kaugummi vom Boden gekratzt und untersucht hatten, von welchen Bakterien er jeweils besiedelt war. 2020 gab es einen Preis für eine Studie über Insektenforscher, die sich vor Spinnen fürchten — vermutlich so ähnlich wie viele Insekten.
Studien mit humoristischem Potenzial zu finden, sei nicht schwierig, meint Mark Benecke: "Die Auswahl ist riesengroß. Auch alte Patente sind eine Quelle ständiger Freude." Und für Benecke ist das kein Zufall: Denn was auf Außenstehende zuweilen witzig wirke, sei der Kern dessen, was Wissenschaft ausmacht. Menschen spezialisieren sich, konzentrieren sich detailversessen bis zur Kauzigkeit auf ihre Forschung und wollen Probleme lösen, die nicht jeder gleich nachvollziehen kann. Dabei wirke jede neue Erkenntnis erst einmal seltsam. "Es liegt in der Natur der Wissenschaft, dass etwas Ungewöhnliches herauskommt." Forscher brächten eben durch Messen und Zählen unkonventionelle Tatsachen ans Licht.
Zum Lachen fehlt dann womöglich nur noch ein kleiner Wechsel der Perspektive. Aber darauf legten es auch Ig-Nobelpreisträger in der Regel nicht an, sagt Benecke. "Niemand reicht eine Studie ein, um bei Science oder Nature eine knackige Überschrift zu bekommen." Für so etwas stecke in der Forschung viel zu viel Arbeit.
Am Anfang stehe vielmehr die Faszination. Er führe immer wieder Mini-Interviews mit Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträgern, erzählt Benecke. "Ich frage sie: Wenn ich 14 Jahre alt wäre, was für einen Tipp hätten Sie für mich? Und die sagen immer: Mach das, von dem die anderen denken, das ist langweilig, doof oder nebensächlich — aber es ist eben dein Ding. Zieh es durch." Wozu es gut ist, was es nützt? Das werde in Deutschland gerne gefragt, meint Benecke. "Aber diese Frage halte ich für Quatsch."
Doch lässt sich die Frage nach dem Nutzen wirklich einfach ignorieren? Unbedingt, meint auch Tilmann Betsch. Denn auch wenn Laien eine anwendungsnahe Forschung erst einmal als sinnvoll empfänden: Schon die Frage nach dem Nutzen führe die Wissenschaft ins Abseits.
Betsch ist Sozialpsychologe an der Universität Erfurt. Er forscht zu Mechanismen der Entscheidungsfindung; und zuletzt hat er in dem Buch "Science matters!" das Prinzip der Wissenschaft erklärt — oder besser: das wissenschaftliche Denken, im Gegensatz zum sogenannten Querdenken. Laut Klappentext war das ein Herzensprojekt.
"Wir sind gut in Evidenz, aber schlecht in der Theorie."
Ob ein Forschungsprojekt nützlich sei? Man könne durchaus beurteilen, ob es wissenschaftlich relevant sei, sagt Betsch. Berücksichtigt es zum Beispiel den Stand der Forschung? Greift es konkurrierende Theorien auf, kann die Arbeit weiterführend sein? Doch in der Praxis stehe hinter der Frage nach Relevanz meist etwas anderes: nämlich die Frage nach einem Nutzen jenseits der Wissenschaft, für ein gesellschaftliches Problem oder auch für das persönliche Vorankommen des Forschers.
Solide Forschung brauche einen theoretischen Rahmen, in den sie eingebunden sei, sagt Betsch. Es brauche Theorien, die dann in Experimenten überprüft würden. Doch wenn sich die Wissenschaft in ihrer Agenda nicht daran, sondern an Ad-hoc-Problemen orientiere, bezahle sie einen hohen Preis, warnt er: "Dann produzieren wir schnell Daten, wir machen ein Experiment oder eine Umfrage. Und dann heißt es: Da haben wir doch Evidenz! Da wissen wir, wie wir Politik machen." Betsch nennt das "eine Art von Forschungspragmatik", aber auch eine "Wissenschaftshektik, die dazu führt, dass wir Müll produzieren". Denn so entstünden Verallgemeinerungen, noch bevor es solide Forschung gibt. Die Wissenschaft müsse sich kritisch in den Blick nehmen, findet Betsch. "Wir sind gut in Evidenz, aber schlecht in der Theorie." Die Corona-Pandemie habe dieses Problem noch verschärft.
Und das alles falle auf die Wissenschaft zurück, warnt Betsch. Denn mit wackliger Forschung mache sie sich angreifbar. "Dann heißt es: Die wissen doch gar nichts. Deshalb ist die Anwendungsfrage mit ein Grund für die Diskreditierung von Wissenschaft."
Was tun? Betsch meint, man müsse sich wieder mehr an Theorien orientieren. Und eines sei immer wichtig: Grundlagenforschung, die gerade nicht nach dem unmittelbaren Nutzen fragt und ohne Zeitdruck entsteht. Solche Forschung sei immer relevant, um sich mit einem möglichst guten Verständnis der Natur für die Zukunft zu rüsten. "Wir wissen ja heute nicht, was morgen für Fragen kommen werden", sagt Betsch. Albert Einstein etwa habe seine allgemeine Relativitätstheorie entwickelt, ohne sich zu fragen, wozu. Dass man diese Theorie braucht, um zum Beispiel Satellitenbahnen zu berechnen, sei viel später klar geworden. Was, wenn Einstein gesagt hätte: Es gibt akutere Probleme als die Raumzeit?
Betsch hat sich deshalb sehr darüber gefreut, dass Svante Pääbo den Medizin-Nobelpreis erhalten hat. Laut Testament Alfred Nobels sollen diese Preise an diejenigen gehen, die im jeweils vergangenen Jahr "der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben". Als vielversprechende Kandidaten galten deshalb die Entwickler der mRNA-Impfung gegen das Coronavirus. Bekommen aber hat ihn Pääbo, ein Biologe, für seine Forschung an alter DNA. Er hatte das Erbgut des Neandertalers sequenziert.
Und auch für die Forschung an alter DNA gibt es inzwischen praktische Anwendungen, sogar im kriminalistischen Bereich, sagt Forensiker Mark Benecke. Ein Beispiel: 2012 fanden englische Archäologen unter einem Parkplatz in Leicester ein verdächtigtes Skelett. Handelte es sich um den verschollenen Körper des 1485 bei einer Schlacht ums Leben gekommenen Königs Richard III., heute bekannt vor allem als Bösewicht bei Shakespeare? Eine Analyse der alten DNA brachte Gewissheit, der alte Monarch wurde daraufhin mit großem Pomp erneut beigesetzt. Und es gebe viele weitere Anwendungen, von der Kriminalistik bis zur Ahnenforschung. Man müsse abseitigen Ideen unbedingt folgen, meint Benecke. "Du kannst nie wissen, was hinterher entdeckt wird."
Es ist deshalb Zeit, eigenwillige Forschung um ihrer selbst willen zu feiern. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass Entenküken deshalb in gerader Linie hinter ihren Eltern herschwimmen, weil sie so auf deren Heckwellen surfen können. Das berichteten Forscher um Zhi-Ming Yuan von der Universität Glasgow im Journal of Fluid Mechanics. Oder die Einsicht, dass Marathonläufer bis zu fünf Minuten schneller sein könnten, wenn sie unterwegs geschickt im Windschatten von anderen laufen.
Das haben Forscher um den Sportwissenschaftler Edson Soares da Silva im Journal of Applied Physiology gezeigt. Der aktuelle Marathon-Weltrekord des Kenianers Eliud Kipchoge liegt bei zwei Stunden, einer Minute und neun Sekunden. Im Windschatten wären demnach Zeiten von unter zwei Stunden möglich. Im Labor ist Kipchoge eine solche Zeit auch bereits gelaufen. Größte Hürde auf dem Weg zu neuen Spitzenzeiten wird in der Praxis nun wohl sein, jemanden zu finden, der schnell genug vorneweglaufen kann, aber nicht selber gewinnen will.
Der niederländisch-britische Wissenschaftler Andre Geim schließlich hat einmal einen Frosch schweben lassen, um zu demonstrieren, dass jeder Körper magnetisch reagiert, wenn nur das Magnetfeld stark genug ist. 2000 hat er dafür einen Ig-Nobelpreis erhalten. Zehn Jahre später wurde er erneut geehrt, diesmal für seine Forschung an Graphenen, strikt zweidimensional strukturierten Kohlenstoff-Kristallen. Diesmal bekam er allerdings den Nobelpreis für Physik in Stockholm. Geim ist der einzige Forscher, der bislang beide Preise gewinnen konnte. Am Ende einer Laufbahn voller Lust an nerdiger Forschung kann etwas sehr Großes stehen.
Mit vielem Dank an die Redaktion für die Erlaubnis zur Veröffentlichung.
Ig Nobel Night
with Mark Abrahams in Berlin