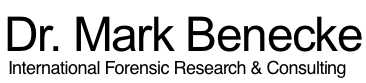2001 05 Sueddeutsche Zeitung: Tanz der Vampirforscher
Quelle: Süddeutsche Zeitung Nr. 117, 22. Mai 2001, S. V2/13
Im rumänischen Schäßburg traf sich die Transsylvanische Dracula-Gesellschaft und tauschte statt Blut neue Erkenntnisse aus
Von: Mark Benecke
Tausend Kilometer lang hat es Raps und gelbes Kreuzkraut in die Felder geregnet. Nun beginnt das Reich des Mohns und der Büsche, die wie riesige Schneekugeln in der grünen Landschaft herumliegen. Angemessenerweise strahlt nach 30-stündiger Zugfahrt der Vollmond: Die Transylvanian Society of Dracula hat zehn Forscher ins Rathaus von Schäßburg gebeten, das nun Sighisoara heißt.
Hier, im heutigen Rumänien, wurde 1431 Vlad Tepes, der Pfähler, geboren. Und hier soll nun ein für alle Mal mit den vielen trüben Annahmen aufgeräumt werden, denen gleichermaßen das Andenken des walachischen Herrschers wie seines Romanpendants Graf Dracula unterliegt. Eine haarige Sache, denn erst einmal will die Unterscheidung zwischen historischem und klinischem Vampirismus gelernt sein.
Klinischerseits fällt sofort auf, dass werdende Vampire eine Persönlichkeitsänderung durchmachen: Sie werden aggressiv, denken unlogisch und fangen an zu beißen. So etwas geschieht jedoch nicht nur bei ausgesprochenen Geisteskrankheiten, sondern ebenso bei Tollwut. Genau mit dieser früher gefürchteten Krankheit, glauben einige Biologen, könnten Menschen Bekanntschaft gemacht haben - vielleicht sogar durch wildgewordene Fledermäuse. Dumm an dieser Theorie ist allerdings, dass solche Ansteckungen durch Flattertiere nur aus Südamerika bekannt sind.
"Was soll daran grausam sein?"
Eine bessere medizinische Erklärung bot erst vor wenigen Jahren der NichtVampirologe Christian Reiter aus Wien. Ihn erinnern die aus dem 18. Jahrhundert überlieferten Obduktions-Berichte von Leichen, denen man blutrünstige Umtriebe nachsagte (und die als Tote gelegentlich wirklich durchs Herz gepfählt wurden), stark an Milzbrandinfektionen. Diese können auch zu blutiger Lungenentzündung führen. Den Obduzenten mag das als schräger Beleg für massives Blutschlürfen, allerdings in das falsche Organ, erschienen sein.
Ändere postmortaie Leichenerscheinungen können aus einem einfachen Toten noch leichter einen Scheinvampirmachen. So kennt jeder Leichenbeschauer das Geräusch, das einem Verstorbenen entweichen kann, der aufgerichtet wird. Die dabei gelegentlich aus den zusammengedrückten Lungen strömende Luft erzeugt nicht nur ein letztes Stöhnen, sondern wird bisweilen auch vom Austritt rötlicher Fäulnisflüssigkeit aus dem Mund begleitet.
Leichen, deren Grab nach einiger Zeit wegen übernatürlicher Verdachtsmomente geöffnet wird, liegen darüber hinaus hin und wieder in einer Körperstellung, die nicht mehr der bei der Einsargung entspricht. Der Grund: Leichengase haben die zeitweise geblähten Glieder verrutschen lassen. Tapfer, wer da nicht an Vampire denkt. Aus der Mode ist angesichts dieser Erklärungen somit die vielleicht älteste medizinische Vampir-Theorie. Sie besagt, dass Porphyrie-Kranke die Wurzel des vampirischen Volksglaubens bilden. Tatsächlich sind diese erbkranken Patienten totenblass und lichtempfindlich. Noch dazu können ihre Zähne rot gefärbt sein.
Auf einem Gemälde von Ferdinand-Joseph Gueldry aus dem 19. Jahrhundert ist eine Reihe solcher Menschen dargestellt, die mit Ekel frisches Stierblut trinken, um ihren stoffwechselbedingten Rlutverlust wieder auszugleichen. Ob Gueldry diese Kranken wirklich gesehen hat, ist aber fraglich: Weltweit sind kaum 250 Porphyriefälle dokumentiert. Den Nörglern unter den Vampirologen ist die Krankheit daher zu selten und zu passend, um wahr zu sein, wie sie auch in Schäßburg betonten.
Erstaunliche Neuigkeiten trugen zu dem die Geschichtskundler der Transsylvanischen Dracula-Gesellschaft zusammen. "Was soll daran grausam sein, zwanzigtausend Türken zu pfählen?" fragte etwa der unerschrockene Historiker Constantin Rezachevici. "Vlad handelte doch nur gemäß Herkunftsrecht." Und tatsächlich: Der Pfähler war ein gebildeter und fanatisch gerechter Herrscher, der Fremde nach den Gesetzen iher Heimat bestrafte. Die Ironie liegt darin, dass die von Vlad beherrschte Walachei, ein Nachbarstaat Transsylvaniens, ausgesprochen milde Strafen vorsah.
Selbst aus einem Mord konnte man sich dort mit etwas Glück freikaufen. Eines der erklärten Ziele war die Besserung der Verurteilten - ein moderner Gedanke, der noch heute manchem Stammtischgast aufstößt. Zur selben Zeit wurden Vergehen, bei denen man in der Walachei mit - zwar gelegentlich geschorener - aber doch heiler Haut davonkam, in Zentraleuropa mit Vierteilen geahndet.
Vlads heute bekannteste Tat, die Errichtung eines ganzen "Waldes der Gepfählten" aus fremdländischen Soldaten, die er zum Sterben auf Pflöcke gesteckt hatte, war nur eine von vielen Spielarten seiner Schreckens-Taktiken, die seine Herrschaft nach außen wuchtig darstellen sollten. Die Pfählung war nicht nur grausam-langsam, sondern noch dazu entwürdigend: In den Augen der türkischen Krieger erhielt ein Gepfählter durch das phallische Tötungsinstrument ein weibliches Attribut. Doch wie fügt sich das alles mit Graf Dracula zusammen, den wir als charmanten Blutlecker aus dem Kino kennen?
Es fügt sich vorne und hinten nicht. Aufgedröselt hat das in den letzten Jahren vor allem Elisabeth Miller aus Kanada, die kürzlich die in einem Bauernhaus aufgetauchten Original-Notizen des Dracula- Autors Bram Stoker sowie die dazugehörige Literaturgeschichte durchgeackert hat. Blickt man genauer in Stokers Notizen und seinen Roman, so lösen sich schöne Vorurteile um den nokturnen Düsterling reihenweise in Sonnenlicht auf: Dass Vlad der Pfähler nie in Transsylvanien, sondern in der benachbarten Walachei, geherrscht hat, ist dem aufmerksamen Leser schon weiter oben aufgefallen.
Und dass der literarische Graf Dracula mit dem echten walachischen Voivoden. nicht viel zu tun haben kann, zeigt sich daran, dass es eigentlich dessen (ebenfalls echter) Vater war, der den Beinamen Dracul führte. Diese Bezeichnung stand aber nicht für den damals in der Walachei mit Drachen verbundenen Teufel, sondern war ein Ordenstitel, den Vlad Senior 1431 in Nürnberg vom Herrscher des Heiligen Römischen Reiches erhalten hatte. Die Mitgliedschaft im Drachchen-Orden brachte nicht nur Ehre, sodern verpflichtete vor allem zum Kampf gegen Nichtchristen und war damit gerade das Gegenteil alles Teuflischen.
Vlad junior, der spätere Pfähler, wurde nur aus einem Grund ein Dracula: Er hieß "der Sohn von Dracul". Romanschreiber Stoker griff auf die beiden realen Draculas zurück, nachdem er ein 1820 erschienenes Buch über die Walachei in einer Bibliothek entliehen hatte. Nur dort taucht der Name der Fürsten auf und wird in den missverständlichen Bezug zum Teufel gesetzt. Stoker selbst war niemals in Osteuropa. Vielleicht hätte er sonst die Heimstatt des Gruselfürsten auch nicht in den BorgoPass verlegt: Erstens gibt es dort kein Schloss (das jetzige Castle Dracula Hotel ist ein Touristengag), und zweitens beschrieb Stoker die Gegend zum Teil falsch. "Waldige Täler gibt es am BorgoPass wirklich", erklärte die drahtige Dracula- Gelehrte Miller, "aber die wild zerklüfteten Wege hat Stoker aus einer Reisebeschreibung kopiert, die eine andere Ecke der Karpaten beschreibt."
Auch aus dem Mittelalter erhaltene Schriftstücke über den Sohn des Dracul geben oft genug nur Märchen wieder, die über Buda, die mächtige Hauptstadt Ungarns, gezielt nach Rom und Deutschland gestreut wurden. Etwa, dass Vlad Tartaren gezwungen habe, ihre gebratenen Anführer aufzuessen. "Alles nicht ernst zu nehmen", lautete das gemeinsame Urteil der Historiker. Die Geschichten sollten den Pfähler entweder diskreditieren oder besonders wehrhaft erscheinenlassen.
Spaß im Familien-Draculaland
Der Untergang der Dracula-Legende steht trotz allem nicht bevor. So haben der schlitzohrige Präsident der Transylvanian Society of Dracula, Nicolae Paduraru, und das rumänische Tourismusministerium die Gründung eines riesigen Familien-Draculalandes angekündigt. Die Themenpark-Macher haben Glück. Wie sich beim Kongress in Schäßburg herausstellte, ist der Roman-Vampir Graf Dracula nicht Sonnenlicht-empfindlich: Im Stoker'schen Buch wandert er mehrfach am Tage umher. Nur eines verliert er, wenn er angeleuchtet wird: seine magischen Kräfte. Drum schließen wir hier den quietschenden Deckel seiner Lieblingskiste und lassen ihn in Frieden ruhen - bis er beim nächsten Kongress wieder ins Rampenlicht treten muss.
Mit großem Dank an die Redaktion für die Erlaubnis zur Veröffentlichung.