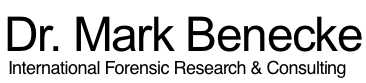Quelle: "Skeptiker", Ausgabe 3/2001
VON MARK BENECKE
Immer neue Filme und Bücher zeigen: Der Dracula-Mythos fasziniert auch uns aufgeklärte Menschen des Computer-Zeitalters. Doch woher kommen die Legenden um untote Blutsauger, spitze Zähne, Särge und Holzpflöcke? Im rumänischen Schäßburg traf sich die Transsylvanische Dracula-Gesellschaft und tauschte statt Blut neue historische und medizinische Erkenntnisse aus.
Tausend Kilometer lang hat es Raps und gelbes Kreuzkraut in die Felder geregnet. Nun beginnt das Reich des Mohns und von Büschen, die wie riesige Schneekugeln in der grünen Landschaft herumliegen. Angemessenerweise strahlt nach dreißigstündiger Zugfahrt auch noch der Vollmond: Die Transylvanian Society of Dracula hat zehn Forscherinnen und Forscher ins Rathaus des irgendwann einmal deutschen Schäßburgs, das heute Sighisoara heißt, gebeten. Hier wurde 1431 Vlad Tepes, der Pfähler, geboren, und hier soll nun ein für alle mal mit den vielen trüben Annahmen aufgeräumt werden, denen gleichermaßen das Andenken des walachischen Herrschers wie seines Romanpendants Graf Dracula unterliegt. Eine haarige Sache, denn erst einmal will die Unterscheidung zwischen historischem und klinischem Vampirismus gelernt sein.
Klinischerseits fällt sofort auf, dass werdende Vampire eine Persönlichkeitsänderung durchmachen: Sie werden aggressiv, denken unlogisch und fangen an zu beißen. So etwas geschieht jedoch nicht nur bei ausgesprochenen Geisteskrankheiten, sondern ebenso bei Tollwut. Genau mit dieser früher weit verbreiteten und gefürchteten Krankheit, so glauben einige Biologinnen und Biologen, könnten Menschen, vielleicht sogar durch wildgewordene Fledermäuse, Bekanntschaft gemacht haben. Dumm an dieser Theorie ist allerdings, dass Tollwut-Ansteckungen durch Fledermäuse nur aus dem tropischen Südamerika, nicht aber aus Europa bekannt sind.
Eine bessere medizinische Erklärung bot erst vor wenigen Jahren der Nicht-Draculaner Professor Reiter vom Wiener Institut für Rechtsmedizin. Er fand, dass besonders die aus dem 18. Jahrhundert überlieferten Obduktions-Berichte von Leichen, denen man vampiristische Umtriebe nachsagte (und die als Tote gelegentlich wirklich durchs Herz gepfählt wurden), stark an eine tödliche Milzbrandinfektion erinnern. Werden Menschen vom Anthrax-Erreger befallen, so können sie sogar eine blutige Lungenentzündung bilden. Den Obduzenten mag das als schräger Beleg für massives Blutschlürfen, allerdings in das falsche Innen-Organ, erschienen sein.
Andere postmortale Leichenerscheinungen können aus einem normalen Toten noch leichter einen Scheinvampir machen. Jeder Leichenbeschauer kennt beispielsweise das Geräusch, das einem Verstorbenen entweichen kann, der auf der Suche nach Rückenverletzungen aufgerichtet wird. Die dabei gelegentlich aus den nun zusammengedrückten Lungen strömende Luft erzeugt nicht nur ein letztes Stöhnen, sondern kann auch vom Austritt rötlicher Fäulnisflüssigkeit aus dem Mund begleitet werden. Leichen, deren Grab nach einiger Zeit wegen übernatürlicher Verdachtsmomente geöffnet wird, liegen darüber hinaus hin und wieder in einer Körperstellung, die nicht mehr der bei der Einsargung entspricht. Der Grund: Leichengase haben die zeitweise geblähten Glieder verrutschen lassen. Ein Tapferer, der da nicht an Vampire denkt.
Aus der Mode kommt damit auch die vielleicht älteste klinisch-naturwissenschaftliche Vampir-Theorie. Sie besagt, dass Porphyrie-Kranke die Wurzel des vampirischen Volksglaubens bilden. Tatsächlich sind die erbkranken Porphyrie-Patienten totenblass und lichtempfindlich – und somit nachtliebend. Sogar ihre Zähne können rot gefärbt sein. Auf einem Gemälde von J.-F. Gueldry aus dem 19. Jahrhundert ist eine Reihe solcher Menschen dargestellt, die mit Ekel im Gesicht frisches Stierblut trinken müssen, um den durch innere Zersetzung und häufige Hautverletzungen bedingten Blutverlust wieder auszugleichen. Ob Gueldry diese Menschen allerdings wirklich gesehen hat, ist fraglich: Bislang sind nicht einmal zweihundertfünfzig Porphyriefälle dokumentiert. Den Nörglern im Fach ist die Krankheit daher zu selten und zu passend, um wahr zu sein. Interessant ist dabei, dass Porphyrie ursprünglich zur Erklärung der „Ätiologie von Werwölfen“ herangezogen wurde. Am 2. 10. 1963 stellte der Londoner Arzt L. Illis auf der Tagung der Royal Society of Medicine einen fürchterlichen Fall von Porphyrie vor, den er einem fotografisch untermauerten Bericht aus dem Jahr 1923 entnahm: Ein narbenübersätes Mädchen mit vom Licht verbranntem Kopf sitzt da traurig auf einem Stuhl und legt die verformten Hände in ihren Schoß. „Die Veranlagung zum Werwolf liegt nach manchen Überlieferungen in der Familie“, sagte Illis damals, „genau wie bei der vererblichen Porphyrie.“ Unsere heutigen Hollywood-Heuler haben dabei wenig mit den Werwölfen des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts zu tun: Diese zeichnen sich in den Chroniken vor allem durch Narben, Blässe und schwere Entstellungen aus. Nimmt man noch die geistige Verwirrung der echten Kranken hinzu, so ist das Bild des besessenen Wermenschen komplett.
Eine ganz andere, aber ebenso spannende Forschungsrichtung bildet neuerdings der historische Vampirismus. „Was soll daran grausam sein, zwanzigtausend Türken zu pfählen?“, fragt beispielsweise der dröge Historiker Constantin Rezachevici in die Runde. „Vlad handelte doch nur gemäß Herkunftsrecht.“ Und tatsächlich: Der Pfähler war ein gebildeter, aber eben auch fanatisch gerechter Herrscher, der Fremde in seinem Land grundsätzlich nach der Art strafte, die in der Heimat der jeweiligen Übeltäter rechtsgültig war. Die böse Ironie liegt darin, dass die von Vlad beherrschte Walachei, ein Nachbarstaat Transylvaniens, ursprünglich eines der wenigen Länder der Erde war, das ausgesprochen milde Strafen verhängte.
So war es beispielsweise üblich, Straftätern einige Stockhiebe zu versetzen, sie mittels eines Schnittes in die Nase zu markieren oder ihnen eine bis zu fünfjährige Fastenzeit, gekoppelt an eine festgelegte Anzahl der Kirche zu überreichender Geschenke, aufzuerlegen. Selbst aus einem Mord konnte man sich in der Walachei mit etwas Glück freikaufen, und eines der erklärten rechtlichen Ziele war die Besserung der Verurteilten – ein moderner Gedanke, der selbst heutigen Zeitgenossen am Stammtisch eher bitter aufstößt. Vergehen, bei denen man in der Walchei mit zwar gelegentlich geschorener, aber heiler Haut davonkam, wurden in Zentraleuropa zur selben Zeit mit Vierteilen, Verbrennen, lebendigem Begraben oder tödlichem Zerbrechen der Gliedmaßen mittels eines Wagenrades geahndet.
Die Anwendung der strengen, fremdländischen Rechtsregeln gab Vlad einen cleveren Grund, seine Herrschaft nach außen wuchtig darzustellen und zugleich das eigene Land durch Abschreckung nach innen in eine Gegend zu verwandeln, von der bewundernd berichtet wurde, dass man „sogar noch im Wald“ seines Eigentums sicher war. Das konnte angesichts von Wegelagerern und Räuberbanden kein einziges zentraleuropäisches Land von sich behaupten.
Die Strafregeln von Byzanz bis ins türkisch-moslemische Reich kannte Vlad nicht nur deshalb, weil er als Kind von den Türken entführt worden war und daher zeitweise mit dem zukünftigen ottomanischen Herrscher, seinem späteren Feind Mohammed II. aufwuchs, sondern auch wegen seiner zahlreichen Verbindungen ins westliche Europa. Diese bestanden, weil die kleine Walachei, eigentlich ein Spielball der großen Mächte, derart an der Grenze zu den Muselleuten lag, dass Vlads kriegsstrategisches Können für die christlichen Staaten rasch unverzichtbar wurde.
Vlads heute bekannteste Tat, die Errichtung eines Waldes der Gepfählten aus einer unbekannten Zahl ottomanischer Soldaten, die er zum Sterben auf Pflöcke gesteckt hatte, ist dabei nur eine von vielen Spielarten seiner Schreckens-Taktiken. Perfide war auch sein Umgang mit feindlichen Truppen, die in die Walachei eingefallen waren. Anstatt die eigenen Soldaten sinnlos der feindlichen Übermacht zu entgegenzustellen, sandte der Pfähler Nacht für Nacht einige harmlose Störenfriede ins Lager der Feinde. Sie traten dort, oft in Kleidung des Feindes gewandet, einen Überfall-Alarm los, machten sich im enstehenden Chaos aber sofort wieder aus dem Staub. Tagsüber schnitt Vlad denselben Truppen, die, wie im fünfzehnten Jahrhundert üblich, grundsätzlich keine Verpflegung mitführten, durch unsichtbare Umzingelung in seinen Waldgebieten alle Versorgungsadern ab. „Nach fünf Tagen und Nächten“, berichtet der rumänische Historiker Mircea Dogaru den verblüfften Dracula-Kundlerinnen und Kundlern, „waren die ottomanischen Soldaten auch ohne Gegenangriff an Ende. Hungrig, durstig und übermüdet fielen ihnen die Waffen aus der Hand.“ War Vlad also ein friedlicher Taktiker?
Nicht ganz. Die Pfählung war beispielsweise nicht nur eine grausam-langsame, sondern auch besonders entwürdigende Todesart: In den Augen der türkischen Krieger erhielt ein Gepfählter durch die phallische Nebenbedeutung des Tötungsinstrumentes ein weibliches Attribut. In einer seiner drei Herrschaftsperioden ging Vlad sogar gegen Steuersünder im eigenen Land mit Pfählungen vor – allerdings erst nach der zweiten Mahnung. Das alles quittieren heutige Rumäninnen und Rumänen mit nachsichtigem Augenzwinkern, andererseits wirkte der bis heute hochgeschätzte Fürst zu einer Zeit, in der es das heutige Rumänien noch nicht gab.
Dass Vlad bis zu seiner Ermordung im Jahr 1476 auch erhebliches Glück hatte, zeigt sich am besten daran, dass er aus einer vom Papst persönlich angeordneten Haft freikam, weil er an der Spitze eines Kreuzzuges gebraucht wurde, der den Christen machtpolitisch gerade in den Kram passte. Göttliche Hilfe oder teuflisches Geschick? Und wie fügt sich das alles mit dem Grafen Dracula zusammen, den wir als charmanten Blutlecker aus dem Kino kennen?
Es fügt sich vorne und hinten nicht. Aufgedröselt hat das in den letzten Jahren vor allem Elisabeth Miller aus Kanada, die kürzlich die in einem Bauernhaus aufgetauchten Original-Notizen Bram Stokers sowie die dazugehörige Literaturgeschichte durchgeackert hat. „Ein echter Bestseller wurde Stokers Roman Dracula erst nach seinem Tod“, sagt die drahtige Professorin, „aber immerhin ist das Buch seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1897 durchgehend lieferbar gewesen“. Blickt man genauer in Stokers Notizen und die Romanfassung, so lösen sich schöne Vorurteile um den nokturnen Düsterling reihenweise in Sonnenlicht auf. Dass Vlad der Pfähler nie in Transylvanien geherrscht hat, ist den Skeptiker-LeserInnen schon weiter oben aufgefallen. Und dass der literarische Graf Dracula mit dem echten walachischen Voivoden Vlad nicht viel zu tun haben kann, zeigt sich daran, dass eigentlich dessen Vater den Beinamen Dracul führte. Diese Bezeichnung stand aber nicht für den damals in der Walachei mit Drachen verbundenen Teufel, sondern war ein westlicher Ordenstitel, den Vlad senior im Jahr 1431 ausgerechnet in Nürnberg vom Herrscher des Heiligen Römischen Reiches erhalten hatte. Die Mitgliedschaft im Drachen-Orden brachte nicht nur Ehre, sondern verpflichtete vor allem zum Kampf gegen Nichtchristen und war damit gerade das Gegenteil alles Teuflischen. Vlad junior, der spätere Pfähler, wurde nur aus diesem Grund ein Dracula: „der Sohn von Dracul“.
Roman- und Theatermann Stoker griff auf die beiden realen Draculas zurück, nachdem er ein 1820 erschienenes Buch über Moldavien und die Walachei in einer Bibliothek im britischen Whitby entlieh. Nur dort taucht der Name der Fürsten auf und wird in den missverständlichen Bezug zum Teufel gesetzt. Stoker selbst war niemals in Osteuropa, geschweige denn im Bereich des heutigen Rumäniens. Vielleicht hätte er nach einem Besuch der Gegend die Heimstatt des Gruselfürsten auch nicht in den Borgo-Pass verlegt: Erstens gibt es dort kein Schloss (das jetzt dort bestehende Castle Dracula Hotel ist ein Touristengag aus den 1980er Jahren), und zweitens verwendete Stoker durch seine Ortsferne eine teils falsche Beschreibung der Gegend. „Obstgärten und waldige Täler gibt es am Borgo-Pass wirklich“, erklärt die kanadische Dracula-Gelehrte Miller dazu, „aber die wild zerklüfteten Wege hat Stoker aus einer Reisebeschreibung kopiert, die eine andere Ecke der Karpathen beschreibt.“ Desillusionierend? Das war noch nicht alles.
„Der Pfähler" wurde der walachische Woiwode Vlad Tepes genannt - weil er türkische Gefangene auf stumpfen Holzstangen aufspießen ließ. Vlad entsprach perfekt dem Bild eines adligen Schurken osteuropäischer Abstammung, den Bram Stoker für seinen „Dracula"-Roman brauchte. Die romantische Geschichte, nach der Vlads erste Frau sich tötet, als sie eine an einen Pfeil geheftete Nachricht entdeckt, auf der zu lesen ist, dass die heimische Burg von Türken umzingelt ist, wird ebenfalls durch kein historisches Dokument gestützt. Selbst wenn sich einmal echte mittelalterliche Schriftstücke finden, geben sie oft genug nur Märchen wieder, die über Buda, die mächtige Hauptstadt Ungarns, gezielt nach Rom und Deutschland gestreut wurden. Eine besonders bizarre Kostprobe, die der US-amerikanische Historiker Kurt Treptow in einer deutschen Quelle ausgegraben hat, lautet: „Als Vlad einmal auf der Straße einen Arbeiter fragte, warum dieser ein kurzes Hemd trage, sagte der, dass seine Frau es gemacht hätte. Darauf befragte Vlad die Frau, was sie den Tag über treibe, und sie antwortete: „Waschen, kochen und weben.“ Da ließ Vlad sie pfählen, gab dem Mann eine neue Frau und schärfte ihr unter strengster Strafandrohung ein, sie solle immer nur langärmlige Hemden für ihren Mann herstellen.“ Eine andere Geschichte erzählt, dass Vlad gefangene Tartaren gezwungen habe, ihre bereits von ihm gebratenen Anführer aufzuessen oder ab sofort in seiner Armee zu kämpfen – „was diese dann bevorzugten“.
„Alles nicht ernst zu nehmen“, lautet das gemeinsame Urteil der auf dem Kongress anwesenden Geschichtskundler. Es handelt sich um Geschichten, die den Pfähler in ein wahlweise schlechtes oder besonders wehrhaftes Licht rücken sollten und sich irgendwann als erzieherische Stories verselbstständigten – mittelalterliche Großstadtlegenden also.
Der Untergang der Dracula-Legende steht trotz alledem nicht bevor. So haben der schlitzohrige Präsident der Transylvanian Society of Dracula, Nicolae Paduraru, sowie das rumänische Tourismusministerium gleich am Kongressort die Gründung eines riesigen Familien-Dracula-Landes angekündigt. Die potentiellen Themenpark-Macher haben Glück. Wie sich beim diesjährigen Kongress herausstellte, ist der Roman-Vampir Graf Dracula nicht gegen Sonnenlicht empfindlich: Im Stokerschen Buch wandert er mehrfach am Tage durch Straßen und Pfade. Nur eins verliert die Roman-Figur, wenn sie zu hell angeleuchtet wird: Ihre magischen Kräfte. Drum schließen wir hier den quietschenden Deckel seiner Lieblingskiste und lassen ihn vorerst in Frieden ruhen – bis er beim nächsten Kongress wieder ins wissenschaftliche Rampenlicht treten muss.
Die besondere Gruftnote: Vampire unter uns
„Ich wurde unverzüglich von einem Mann angesprochen, der einen schwarzen Gehrock und eine schneeweiße Krawatte trug. Er hatte schwarze Haare und einen sorgfältig gestutzten Bart, der in einer dünnen Linie von seinen Ohren ausgehend um seine Lippen lief und sich über den kleinen weißen Vampirzähnen leicht kräuselte. Seine Wangen waren glattrasiert, und ich schätzte ihn auf Mitte 30. ,Tagsüber bin ich Bauarbeiter’, eröffnete er mir. ,Aber ich sehe mich selbst als Vampir...’“
So schildert die amerikanische Journalistin Katherine Ramsland ihren ersten Kontakt mit der New Yorker Vampir-Szene. Dahinter verbirgt sich eine Subkultur aus schätzungsweise einigen hundert Menschen, die die Vampir-Mythologie in ihr Leben und in die moderne Kultur integrieren. Landesweit sollen rund 10 000 Mitglieder zum harten Kern der Vampirgemeinschaft zählen, behauptet das „Vampire Research Center“; die Anzahl der Interessierten an der Pheripherie sei ungefähr zehnmal so hoch. Vampir-Communities existieren außer in New York angeblich in New Orleans, Los Angeles, Chikago und London.
Die meisten heutigen „Vampire“ leben eine Art ästhetischen Fetischismus aus: „Es gefällt mir, wie wir unsere Phantasien sexuell, theatralisch und romantisch ausleben und wie wir Kostüme benutzen, um es richtig echt aussehen zu lassen“, erklärt der ehemalige Zahntechniker „Father Sebastian“, eine Schlüsselfigur der New Yorker Szene. Zum Vampir-Lifestyle gehört unter anderem das Tragen von Zähnen, Kontaktlinsen, blassem Make-up sowie ein bestimmtes Sozialverhalten. „Vampire können entweder einsame Wesen sein oder sich zu Zirkeln zusammenschließen“, erzählt „Father Sebastian“ weiter. „Ein Zirkel ist eine Gruppe von Freunden und/oder Liebhabern, die sich ein Versprechen gegeben haben. Enge Zirkel haben selten mehr als drei bis fünf Mitglieder, während etwas offenere Zirkel bis zu 13 Mitglieder haben können.“ Übrigens unterscheidet Sebastian zwischen „Vampir“ und „Vampyr“: „Wenn wir Vampir sagen, meinen wir das Wesen aus den Legenden. Mit Vampyr meinen wir die modernen Vampir-Liebhaber.“
Ihren Besuch in einem geheimen New Yorker Vampir-Club schildert Katherine Ramsland so: „Die vorherrschende Farbe der Kleidung ist Schwarz, Kerzen oder gedämpftes Licht verstärken die Atmosphäre. Die Männer tragen vielfach Spazierstöcke und überladen ihre Hände mit Silberschmuck; Frauen tragen Kleider, Korsagen, Hüte und Frisuren in einem phantastischen Stil. Ich sah ein Mosaik aus schweren Halsbändern, Plateaustiefeln, engen schwarzen Jacken, schwarzem Lippenstift, Bauchnabel-Ringen, langen silbernen Krallen, Totenkopf-Hemden und Latexkleidung jeglicher Art. Es gab nichts Billiges oder Abgetakeltes hier.
Mir fiel eine Frau in einem langen, schwarzen Kleid auf, die einen breitrandigen Hut mit einem schwarzen Spitzenschleier trug, der ihr Antlitz verbarg. Ich nahm an, dass sie durch ihn hindurch sehen konnte, aber ich vermochte ihr Gesicht nicht zu erkennen. Eine andere trug enge, schwarze Hosen, hochhackige Schnürstiefel und eine Gummi-Korsage. Einige trugen Vampir-Make-up (etwas Blut im Mundwinkel, um ein Mahl vorzutäuschen), und viele waren mit spitzen Zähnen ausgestattet, aber andere zeigten einfach ihr wahres Gesicht. Jeder der Anwesenden ging seinen eigenen Wünschen und Vorlieben nach, ohne die anderen zu verurteilen.“ In einigen Clubs überschneiden sich Vampir-Partys offiziell und inoffiziell mit der S/M-Szene.
Ein großer Teil der Vampir-Kultur besteht aus Maskerade und Spiel. Daneben gibt es aber auch „Vampire“, die sich gegenseitig die Haut aufschlitzen, um einander ihr Blut darzubieten – oder gar zu trinken. Dieser Austausch wird in erster Linie als Transfer von Lebensenergie betrachtet. Es geht dabei weniger um das Blut selbst als um die Empfindung von Nähe und Erregung. Der selbst ernannte New Yorker Vampir Ethan Gilcrest etwa bezeichnet Blut als „flüssige Elektrizität“. Oft bleibt es dabei aber auch nur beim Saugen an der Hautoberfläche, wobei höchstens „Knutschflecken“ entstehen.
Die dritte zahlenmäßig bedeutsame Gruppe in der Vampir-Subkultur bilden die so genannten Psycho-Vampire. Diese sind überzeugt, von der „Aura“ anderer Menschen zehren und ihnen auch ohne deren Wissen „Kraft“ rauben zu können. Was ist davon zu halten? „Ich habe einige Menschen kennen gelernt, die angaben, psychische Vampire zu sein“, schreibt Ramsland. „Sobald ich sie jedoch einem Test unterzog, hatten sie alle möglichen Ausreden parat, warum nichts dabei herauskam. Ich forderte sie auf, sich an mir zu versuchen – ich wollte herausfinden, wie es sich anfühlt, wenn einem die Lebenskraft ausgesaugt wird. Sie lehnten immer ab, entweder weil sie nicht wollten, oder weil ich zu konzentriert war oder zu den seltenen Menschen gehörte, die dagegen immun seien.“
Der Kölner Kriminalbiologe Dr. Mark Benecke, der die Vampir-Szene in New York ebenfalls über mehrere Jahre ausforschte, hat bei vielen „psychischen Vampiren“ eine gedämpfte, melancholische, ins Depressive gehende Grundstimmung ausgemacht – „nicht klinisch auffällig, aber als ein Charaktersplitter“. Denkbar, dass Jugendliche und junge Erwachsene, die glauben, selbst nicht genug „Lebenskraft“ zu produzieren, im psychischen Vampirismus eine Art Junkfood-Spiritualität suchen, die ihnen das Gefühl von Macht und Kontrolle über die Umstände und zugleich die Sinnlichkeit verleiht, die sie vermissen. Darüber hinaus scheint der psychische Vampirismus ein Mittel zu sein, die Verbindung mit okkulten Kräften vorzutäuschen.
Wie jede Subkultur ist auch die Vampir-Szene sehr vielfältig und die Übergänge zwischen den einzelnen Ausprägungen (bis hin zum pathologischen Blut-Fetischismus) fließend. Der amerikanische Religionswissenschaftler Mark T. Spivey wagt die Prognose, dass „der Vampirmythos wächst und sogar zu einem eigenen Lebensstil wird“. Zu den Gründen meint Spivey: „Ich glaube, der Vampir gibt diesen Leuten ein gesteigertes Selbstwertgefühl. Vampire offerieren den Teenagern Selbstbewusstsein. Sie erleichtern es ihnen, traurig, ein Außenseiter und missverstanden zu sein. Das Daseins des Vampirs, wie immer es beschrieben wird, ist eine genaue Kopie des Generation-X-Lebensgefühls: dunkle, mysteriöse Antihelden, die sich vom Blut der Gesellschaft ernähren, um zu überleben – und überleben wollen sie auf jeden Fall.“
Katherine Ramsland indes zeigte sich am Ende ihrer Recherchen eher enttäuscht: Die moderne Version des Vampirs – herkömmliche Nahrung essen, Energie stehlen, Verhaltensregeln aufstellen, in Clubs tanzen – sei in keiner Weise vergleichbar mit dem pulsierenden Mysterium, das dem klassischen Vampir in der Literatur und auf der Leinwand anhaftet. Bernd Harder
Blut-Ergüsse
Voltaire nahm den Vampir als Bild für den Adel, der sich mit aller Macht gegen das aufstrebende Bürgertum wehrt und seine Dominanz zu retten versucht, Karl Marx wenig später fürs Kapital. Der zeitgenössische Bestseller-Autor Stephen King ist dagegen fasziniert von Dracula und Co., von deren Anarchismus und zeitloser Existenz: „Vampire leben ewig. Sie haben keinen festen Job und müssen sich keinen Arbeitszeiten unterwerfen. Sie sind die ganze Nacht unterwegs und schlafen den ganzen Tag. Und sie haben eine starke sexuelle Natur.“
1897 brachte der irische Schriftsteller Bram Stoker seinen Briefroman „Dracula“ heraus. Binnen kurzem verkaufte sich das Grusel-Epos mehr als eine Million Mal – eine Tatsache, die wohl erst in zweiter Linie etwas mit der literarischen Qualität des streckenweise recht zähen Schauerstücks zu tun hatte. Denn unter ihrer unheimlichen Oberfläche ist Stokers Erzählung eine subtile Metapher auf die Doppelmoral und ängstliche Lustfeindlichkeit des viktorianischen Zeitalters: „Dracula“ als zwielichtiger Anti-Held auf einem Kreuzzug gegen Tabus und Prüderie, geradezu über-sinnlich den sexualpsychologischen Dreiklang Blut, Lust und Tod anschlagend.
Mehr als 200 Mal ist „Dracula“ seither allein fürs Kino seinem Grab entstiegen. Berühmte Autoren, von Alexandre Dumas oder Arthur Conan Doyle bis hin zu Gogol und Maupassant, haben dem Vampir-Mythos frisches Blut zugeführt; denn „Dracula“ erweist sich immer wieder aufs Neue als Projektionsfläche, die größer ist als jede erzählerische Phantasie. „In die Figur des Vampirs lässt sich alles, aber auch wirklich alles hineinlesen“, urteilt der Spiegel: „Mal ist er Liebhaber und Verführer, mal Blutsauger und Zerstörer. Er ist böse und triebhaft, witzig und weltläufig, süchtig nach Blut und sehnsüchtig nach Verschmelzung, ein Untoter ohne Ruhe und ein Rastloser, der sich nach ewigem Schlaf sehnt.“
Wann aber der letzte Sargdeckel für den Blutsauger fällt, ist ungewiss. Zu tief wurzelt die Figur in den kollektiven Sehnsüchten, Ängsten und verdrängten Trieben von uns Normalsterblichen. Wie heißt es in einem aktuellen Vampir-Buch treffend: „Sleep all day, party all night, never grow old, never die!“ Bernd Harder
Dr. Mark Benecke arbeitet international als Kriminalbiologe. Für die Transylvanian Society of Dracula ist er der „Konsul der Rheinlande“ und führt derzeit auch den Vorsitz der Gesellschaft. Er ist Autor des Buches „Der Traum vom ewigen Leben“ (Kindler, 1998) und gehört dem Wissenschaftsrat der GWUP sowie dem wissenschaftlichen Beirat des Skeptiker an.