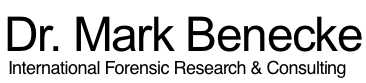Aufgezeichnet von Michal Welles
Gebundene Ausgabe: 219 Seiten
Verlag: Hannibal; Auflage: 1 (28. März 2011)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 9783854453444
ISBN-13: 978-3854453444
ASIN: 3854453442
Größe und/oder Gewicht: 23,8 x 16,2 x 1,8 cm
VORWORT VON MARK BENECKE
Das hier ist ein richtig gutes Buch. Wirklich. Es beginnt mit einer jüdischen Journalistin, die befangen und vernebelt von ihrer vermurksten Jugend in die Arme des charismatischen Zausels Charles Manson stolpert. Er versucht eigentlich nur, zusammen mit seinen wenigen Kumpels und aus dem Knast heraus, tausenden von BriefeschreiberInnen und BesucherInnen das abzuschmeicheln, was von ihnen zu holen ist: Geld, Drogen, Sex und Aufmerksamkeit.
Anders als die harten Fans, die ihr Leben wegwerfen, in die Nähe des Knastes ziehen und dort für den Rest ihres kümmerlichen Daseins Häuptling Manson lauschen, tickt die Journalistin ein wenig anders. Zwar lechzt auch sie nach Verständnis und Zuneigung durch das Monster, ist aber zugleich derart von Zweifeln zerfressen, dass sie rechtzeitig aufpasst. Manson, der schon im christlichen Kinderheim nur schwer Erziehbare gelernt hat, wie man andere einschätzt, um sie auszunutzen und zu überleben, erkennt die Schwäche seiner Besucherin gleich beim ersten Treffen. Weil er aber eine respektvolle Zuhörerin gefunden hat, die ihm zudem in ihrer Unsicherheit ähnelt — und auch, weil seine Kräfte merklich schwinden —, schildert er ihr im Laufe der kommenden 20 Jahre sein Dasein so fragmentarisch und wüst, wie es war.
Dabei ist Manson eigentlich bloß der stereotype Hardcore-Knacki: die Sorte, bei der man nie weiß, ob sie gerade lügt und trickst oder aber die Wahrheit sagt, um dadurch besser lügen und tricksen zu können. Mansons Mutter soff, hatte einige Schrauben locker und parkte ihren Jungen angeblich mit Tränen in den Augen - für immer bei der Großmutter. Von dort aus trat der vernachlässigte Junge seinen einsamen Weg durch eine Welt an, die meist aus Heimen und Gefangnissen bestand. So weit, so typisch.
Dennoch hat Manson ein tückisches Etwas — etwas, das mir erst nach vielen Gerichtsverhandlungen, einer Menge verbeulter Fälle (andere landen bei mir komischerweise nicht) und endlosen Gesprächen mit einer Psychologin aufgefallen ist. Denn der verstrubbelte Irre ist nicht zufällig das in der neueren Geschichte bekannteste Beispiel für etwas eigentlich Widersinniges: einen strahlkräftigen Täter. Serienmörder wie Jürgen Bartsch oder Frank Gust sind dagegen Lichtjahre von Mansons Charisma entfernt, obwohl sie sich viel klarer über ihr Leben geäußert haben.
Zwar ähneln gefühlskalte Täter wie diese beiden Charles Manson in ihrer oft richtigen Kritik an sozialem Unsinn (den sich aber auch jeder Rapper von der Seele schreibt), und auch in ihrer steuernden und auf sich selbst bezogenen Art sind sie ihm gleich. Doch niemand außer Manson erreichte je den Ruf und die Möglichkeit, Ratgeber, Tröster und Leitstern für Schwache und Verbogene zu sein. All das ist Manson, weil er aus seinem eigenen seelischen Hohlweg zwar eine völlig eingeschränkte Sicht auf die Welt hat, dafür aber auch weniger von ihr abgelenkt ist. Er sieht daher klarer, was schief läuft — weil er es selbst erlebt. Er sagt Wahres, weil er so verletzt ist, dass ihn nichts mehr daran hindert, das Fürchterliche wahrzunehmen. Und er bezahlt für alles mit einer entsetzlichen Währung: Gefühlschaos. Wenn er von Liebe schwärmt, dann so, wie es die Journalistin gerne hätte. "Ich begebe mich auf eine Art Liebesreise", sagt Manson, "um die Frau, die ich liebe und die mir wichtig ist, glücklich zu machen.
Nein, damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Techniken, was Sex und Stellungen angeht. Es geht mehr darum, die Poesie zu entschlüsseln, die in ihren Körper gemalt wurde und die ganz einzigartig ist. In der Hinsicht habe ich ein ganz besonderes Talent, Frau, ich kann die Geheimnisse einer Frau entschlüsseln und sie dazu bringen, sich selbst zu erkennen."
Doch damit ist es im Hochsicherheitstrakt des Knastes schnell vorbei. "Wenn ein Mann sich in einen Mann verliebt, wo ist das Problem?", meint er nun viel pragmatischer. "Hinter dem ganzen romantischen Disneyland-Scheiß und dem Feuerwerk beim Sex muss doch eine tiefere Bedeutung stecken. Hier geht es darum, dass man allein ist, dass man Angst hat, dass man nicht weinen kann, dass niemand kommt, der einen tröstet. Ich hatte eine Menge Jungs, die ich mochte und wollte und rangenommen hab, na und?" Wer würde diesen Mann nicht gerne in sein Haus und Herz lassen und ihn tröstend in den Arm nehmen? Doch Vorsicht ist geboten, wie einer seiner Knast-Kollegen berichtet: "Charlie ist echt ein großzügiger Typ, wenn man ihn ein bisschen kennt. Ich mag ihn, das muss ich noch einmal ganz deutlich sagen. Und trotzdem, er hätte mich sofort in den Arsch gefickt, wenn ich ihm die Gelegenheit gegeben hatte — was ich allerdings nie tat."
Eins ist Manson: Am Leben. Und weil so viele das nicht sind, entwickelte er sich zu einem wunderbaren, wenngleich auch ziemlich wunderlichen Guru. Hinzu kommt noch etwas. Egal, wieviel Scheiße ein bei Manson Rat Suchender in seinem Leben schon fressen musste: Manson hatte grundsätzlich mehr davon abgekriegt. Das ist praktisch für die Jünger, denn so hat der Guru mehr gesehen und weniger Mitleid, so wie ein Profi-Bergsteiger, der dem Anfinger die großen Praxis-Tipps gibt, anstatt mit ihm über Fersen zu heulen, die er sich im Wanderschuh aufgescheuert hat.
Ihre seelischen Schmerzen kennen die JüngerInnen ohnehin gut genug. Sie wollen Lösungen. Und die hat Manson: Das Versprechen einer heilen Welt mit gesunden Bäumen, frischem Wasser und jeder Menge Liebe. Natürlich lassen sich diese ultrakonsensuellen Träume eigentlich kaum verkaufen, wenn man selbst ein Ungeheuer ist. Doch Mansons Gefolgsleute brauchen den von ihnen als superstark empfundenen Überbösewicht als Chefideologen, weil sie selber keinen Mumm mehr in den Knochen haben. Der wurde ihnen nämlich irgendwann von irgendwem gründlich aus dem Körper geflucht, geprügelt und gevögelt. Manson weiß das, und seine Kumpels im Knast wissen das auch. Dennoch kann man ihm schlecht vorwerfen, dass er sich aufrichtig nach einer besseren Welt sehnt.
Zudem sind Mansons Wüten und Toben ebenso wie seine endlosen Grimassen, Faxen und Clownerien, seine gruftimäßig-pubertären Gedichte nebst der wollsockigen Vorschläge zur Weltverbesserung samt Enttarnung pädophiler Scheinheiliger im guten Sinne rührend. Auch wenn er sehr leicht erkennbar versucht, aus diesen Zutaten ein jahrzehntelang eingeübtes Rührstück zu brauen, glaubt man ihm dennoch eigentlich alles. Dazu muss man ihn allerdings, auch als Profi, erst einmal ausreden lassen. Denn Manson überschätzt sich nicht, und das macht ihn sympathisch. Er weiß, dass er bloß ein Wurm ist, dem durch einen zeitgeschichtlichen Witz zuerst der Job des Wishmasters und dann der des schwarzen Mannes zugefallen ist. "Dir ist doch klar", teilt er der mittlerweile zur guten Freundin gewordenen Interviewerin mit, "dass ich bloß ein Penner bin, oder? Ein Penner, der dir mit wenigen Worten vermittelt, dass du okay bist und dass du dich lieben sollst." Punktlandung. Vielen Menschen gibt noch nicht einmal der Lebenspartner dieses einfache und wichtige Gefühl. Manson hingegen ist Profi im Persönlichkeitsaufbau anderer. Kein Wunder, dass die Menschen ihn lieben.
Selbstverständlich ist Manson auch ein Zerrbild der Hippie-Zeit, die ihn erst als das ambivalente Phantom erschuf, das er bis heute ist — sogar in einer Weihnachtsfolge der Serie South Park. Denn nur unter denjenigen, die die Welt Ende der 1960er Jahre für einen kurzen Augenblick ändern wollten, konnte sich Manson angenommen und wohl fühlen. Sie hörten dem seelisch verkochten Irren nicht nur zu, sie sagten ihm auch das, was er heute seinen Schäflein predigt: Nämlich dass er okay sei und sich nur locker machen brauche. Verständlich, dass Manson so bis heute behaupten kann, dass er niemanden zu Morden angestiftet, sondern den Menschen bloß gezeigt habe, was in ihnen steckt. Das ist ihm gelungen. Tataa!
In Wirklichkeit ist diese Aussage eine blöde Rechtfertigung seiner damaligen Rolle als Anstifter und Aufwiegler. So abgebrüht ist Manson allerdings nicht, als dass er sich im Laufe von zwei Jahrzehnten nicht doch in den Interviews verplappert und verraten hätte:
"Mein Verbrechen bestand darin, dass ich [nach dem ersten Mord] nicht sofort die Bullen anrief und die Mädchen festnehmen ließ. Dort, wo ich herkomme, tut man so etwas nicht. Deine Gang ist ein Teil von dir, im Guten wie im Bösen, im Recht oder Unrecht. Ich habe ihnen [den Mitgliedern seiner "Family"] gesagt: Wenn sie es richtig machen wollten, dann würden sie es noch einmal tun müssen, aber richtig professionell." Tja. Nicht alles, was logisch ist, ist allerdings auch unterstützenswert. Hier räumt Manson seinen Part als Triebfeder des Ganzen also unumwunden ein. Seine Gefühlskälte macht ihn so stumpf gegen sich selbst, dass er sein Geständnis gar nicht bemerkt.
Und damit komme ich zum Ende. Manson ist der mit Abstand gruseligste Clown, aber auch der traurigste und irrste Straftäter, von dem ich je gelesen habe. Das liegt nicht nur an seinen eigenen Schilderungen, in denen das Wüten und der Wahnsinn seiner Denkgebäude gar nicht richtig zum Vorschein kommen. Viel eindrücklicher bricht das Höllische aus den ebenfalls hier abgedruckten Erinnerungen seines Zellengang-Genossen hervor, die mir wahrscheinlich Alpträume en gros bescheren. Denn wie Manson seine Zelle Woche für Woche in eine dunkle Höhle voller Krempel und Kram verwandelt, wie er sich für seine Haustier-Spinne in den Karzer hinein tobt, um dort dann tagelang an der Tür stehen zu bleiben, wie er aus Urin und Getränkepulver Farben mischt, um Skorpione aus alten Unterhosenbändern zu basteln — dagegen ist der Kellergang, in dem Hannibal Lecter mit seinen verrückten Mitgefangenen lebt, ein wohltemperiertes Frühstück mit englischer Orangenschalenmarmelade, Drei-Minuten-Ei und frisch aufgebackenem Croissant. Lassen Sie sich überraschen.
Aber jetzt halte ich besser die Schnauze — ich höre mich ja schon an wie ein verdammter Gesellschaftskundelehrer.